CfP: Sammelband
Inklusion oder Vorurteil
Literary Disability Studies in Einzelinterpretationen
Die Literary Disability Studies als eigenes Format der Disability Studies sind in der germanistischen Literaturwissenschaft noch in der Etablierungsphase. Neben vereinzelten Veröffentlichungen ist ein entsprechender Band von Matthias Luserke-Jaqui (2019) zu nennen, eine größere Dynamik hat das Forschungsfeld durch das DFG- Netzwerk „Inklusive Philologie“ bekommen, wodurch weitere Publikationen und Tagungen in der Planung sind (s. hier).
Eine deutlich längere Geschichte hat der philologische Umgang mit (Themen und Motiven von) Behinderung in der Fachdidaktik Deutsch: einerseits durch die bemerkenswerte Präsenz von behinderten Figuren in der Kinder- und Jugendliteratur, andererseits durch die Fokussierung auf Inklusion im (Deutsch-)Unterricht. Der geplante Band will beide Arbeitsbereiche nun zusammenführen und dazu beitragen, dass sich dieses Forschungsfeld im vielfältigen Spektrum der Methoden und Praktiken der Philologie weiter etabliert. Dabei ist ein möglichst breites Feld an Zugängen und Perspektiven zum Thema vorgesehen – die einzige verbindliche Vorgabe ist, dass es sich um Einzelinterpretationen handeln muss, die einen einzigen literarischen Text (bei einem kulturpoetischen Textbegriff, der z.B. auch Graphic Novels oder Bildergeschichten berücksichtigt) analysieren. Dies kann entweder z.B. im Rahmen einer textnahen Interpretation sein, oder in der fachdidaktischen Überlegung, wie ein literarischer Text inklusiv im Unterricht vermittelt werden kann. Welche Konzepte von Behinderung dabei zur Anwendung kommen, liegt allein in der Entscheidung der Beiträgerinnen und Beiträger: Das Ziel soll die Repräsentation einer Vielfalt von Perspektiven sein. Die Einzelinterpretationen sollen dabei nicht den impliziten normativen Anspruch von Modellinterpretationen vermitteln, sondern eher tentativen, exemplarischen Charakter haben.
Zur Veranschaulichung seien zwei Beitragsmöglichkeiten vorgestellt, die auch gerne selbst in einen Themenvorschlag münden können: Ein moderner Klassiker, der sich mit dem Thema Behinderung, aber auch mit dazu gehörigen pädagogischen Fragestellungen beschäftigt, ist André Gides „Die Pastoral-Symphonie“, wo es um die Erblindung einer jungen Frau geht. Informativ wäre beispielsweise auch ein historischer Überblick über die forschungsgeschichtliche Rezeption der Klara-Figur in Johanna Spyris „Heidi“ – eine der berühmtesten behinderten Figuren der neueren (Kinder- und Jugend- )Literaturgeschichte, wo auch das heikle Thema der Heilung eine Rolle spielt. Der literarische Text muss nicht zur deutschsprachigen Literaturgeschichte gehören, aber in deutscher Übersetzung vorliegen. Die Beitragssprachen können deutsch und englisch sein.
Beitragsvorschläge sind erbeten bis zum 30.06.2024 an:
Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Jürgens h.juergens@lfd.rwth-aachen.de
PD Dr. Matthias Berning m.berning@germlit.rwth-aachen.de
Der Sammelband soll in der von Prof. Dr. Klaus Birnstiel und Dr. Johannes Görbert gegründeten Reihe „Behinderung – Literatur – Kultur“ im Freiburger Rombach-Verlag (Rombach Wissenschaft) erscheinen.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auch hier.
(Quelle: Homepage kinderundjugendmedien)
CfP und Tagung: Das schlechte Bilderbuch
Zu einer seltenen, aber notwendigen Wertungspraxis in der Kinderliteraturkritik
Termin: 25. bis 27.07.2024
Ort: Zoom-Tagung
In der Praxis der institutionalisierten Kinderliteraturkritik fällt zweierlei besonders auf: Zum einen richtet sich die Besprechung der Texte nicht vornehmlich an die kindliche Leser*innenschaft (als intendierte Adressat*innengruppe), sondern an die erwachsenen Gate Keeper, zum anderen – und das soll als anzunehmende Folge dieses Umstands im Zentrum stehen – wird die Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich auf die Betrachtung wertvoller bzw. als gut befundener Literatur gerichtet, was Positivbesprechungen bzw. Empfehlungen im Sinne positiver Sanktionierung (vgl. Ewers 2012: 17) zur Folge hat.
Im Wesentlichen lässt sich im Zusammenhang mit der zweiten Feststellung zwischen zwei Grundtypen in der KJL-Kritik unterscheiden und zwar zwischen der pädagogisch-didaktischen und der literarästhetisch argumentierenden Ausrichtung. Die pädagogisch-didaktische Position wünscht sich „KJL als ein möglichst qualitätsvolles Textangebot für junge Lesende [...], oftmals v. a. für den unterrichtlichen Zusammenhang, aber auch als sinnvolle Freizeitlektüre.“ (Roeder 2015: 277). Insofern wird KJL ein dezidierter Nutzen zugesprochen, der in der – mal mehr, mal weniger moralisch ausgerichteten – Enkulturation des heranwachsenden Individuums besteht (vgl. Raithel/Dollinger/Hörmann 2009: 60). Eine solche ‚Gebrauchswert-Kritik‘ wird schon lange von Seiten der KJL-Forschung beanstandet, wie z.B. von Klaus Doderer, wenn er 1981 feststellt, dass Kinder- und Jugendbuchkritik „fast ausschließlich Inhaltsbeschreibungen mit anschließender Bemerkung über Nutzen und Effekt des Werkes“ (Doderer 1981: 13) beinhalte und sich darin von der sonstigen Literaturkritik wesentlich unterscheide.
Demgegenüber bemüht sich die literarästhetische KJL-Kritik zwar prinzipiell um das literarische Werk in seiner ästhetischen Gestaltung, setzt diesen Anspruch aber oft unzureichend um, wie z.B. Judith Witzel in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2005 herausstellt, in der sie konstatiert, dass die Rezensent*innen sich zwar oberflächlich betrachtet an analytischen, wertungsaffinen Begrifflichkeiten orientieren, dabei jedoch trotzdem zu vage gehaltenen, floskelhaften Wertungen mit geringer Aussagekraft gelangen. Wenn ein Kinder- bzw. Jugendbuch als Ergebnis „erzählerische[n] Können[s] [in] Höchstform“ oder „sprachliche[r] Kunstfertigkeit“ (Witzel 2005: 70) bezeichnet wird, aber unklar bleibt, wie diese Eigenschaften zu verstehen sind und worin genau sie sich im betrachteten Gegenstand äußern, treten dogmatische Setzungen an die Stelle argumentativ nachvollziehbarer Kritik.
Auch auf das Bilderbuch trifft die oben grob skizzierte Wertungspraxis immer wieder zu. Das (zumeist) Bild- und Schrifttext kombinierende Medium, in dem die beiden eingesetzten Zeichensysteme in einem variierenden Wechselverhältnis zueinander stehen können, macht es erforderlich, den Blick zwischen Bild- und Schrifttext hin- und herwandern zu lassen. So kann sein kompositorisches Grundprinzip immer wieder neue Herausforderungen an die Lesenden stellen, die vornehmlich die Reihenfolge der zu rezipierenden Elemente und ihre Bedeutungserschließung in der Zusammenschau betreffen (Staiger 2022: 4–5). Die Realisierungsmöglichkeiten einzelner Bilderbücher sind enorm vielfältig: Sie speisen sich aus Themen, Stoffen, Motiven, Gattungen, Komplexitätsgraden und sprachlichen wie auch visuellen Gestaltungsmodi, die auch aus anderen Kunstformen bekannt sind. Dennoch herrscht in der öffentlichen (nicht fachwissenschaftlichen) Diskussion trotz weiterhin zunehmender Auffächerung der Themen, Adressierungen und Gestaltungsformen die Ansicht vor, dass sich das Bilderbuch vornehmlich an Kleinkinder und Leseanfänger*innen richte (Staiger 2022: 5).
Die Diskrepanzen, die sich entlang öffentlicher Wahrnehmung, eventueller moralischer Implikation, jeweiliger Kindheitsvorstellung und gegenstandsbezogener Vielfältigkeit eröffnen, lassen das Bilderbuch als besonders geeigneten Vertreter erscheinen, die Wertungspraxis zum Kinderbuch um argumentationsstarke, demnach gut begründete, Kritiken zu erweitern, die es ermöglichen, Spezifika transparenter und vielfältiger Kinderbuchkritik herauszuarbeiten. Dabei kommt der Fokussierung auf schlechte Bilderbücher eine ganz besondere Rolle zu: Nicht allein der Umstand, dass eine negative Kinderbuchkritik nahezu unsichtbar ist, sondern mehr noch die Notwendigkeit, der sich der bzw. die Kritiker*in ausgesetzt sieht, besonders nachvollziehbar und verständlich argumentieren zu müssen, um nicht polemisch bzw. herabwürdigend zu agieren, lässt das aus einer jeweils zu erörternden Perspektive als schlecht befundene Bilderbuch zu einem besonders reizvollen und vielversprechenden Gegenstand werden.
Der Arbeitsbereich Sprachliche Grundbildung/Literaturdidaktik der Universität Bielefeld freut sich über Beitragsvorschläge (maximal 3000 Zeichen Länge) für maximal 30-minütige Vorträge bis zum 30.04.2024 (einzusenden an ulrike.preusser@uni- bielefeld.de), die aus einer eindeutig bestimmten Perspektive einen Blick auf ein ausgewähltes Bilderbuch werfen und wohlbegründete Kritik an diesem üben. Dabei werden nicht nur literatur- , sprachwissenschaftlich oder pädagogisch ausgerichtete Vorschläge und solche aus allen anderen fachdisziplinären Zugängen und ihren Didaktiken begrüßt, sondern auch aus der Schulpraxis und dem Buchhandel. Eine Publikation der vorgestellten Beiträge ist geplant.
Mögliche Perspektiven:
- Literarische, sprachliche und medienästhetische Wertungspraxen
- Literaturtheoretische Wertungsperspektiven (Hermeneutik, (Post-)Strukturalismus, Psychoanalytische Literaturwissenschaft, Diskurstheorie etc.)
- Intersektionale Literatur- und Medienkritik (race – class – gender)
- Literatur- und Medienkritik der Postcolonial Studies, Human-Animal Studies Schulpraktische Überlegungen
- Bildungswissenschaftliche/pädagogische Perspektiven
- Weitere fachdidaktische Zugänge –z.B. Kunst, Englisch, Religion, Philosophie, DaF/DaZ, Mathematik, Naturwissenschaften
Literatur:
- Doderer, Klaus (1981): Kinder und Jugendliteratur im Ghetto? In: Doderer, Klaus (Hrsg.): Ästhetik der Kinderliteratur. Plädoyers für ein poetisches Bewußtsein. Weinheim und Basel, 9–17. Ewers, Hans-Heino (2012): Literatur für Kinder und Jugendliche. 2. Aufl. Paderborn 2012.
- Roeder, Caroline (2015): Das Elend unserer Kinderliteraturkritik. Positionsbestimmung für eine peripher gescholtene Sparte. In: Gansel, Christina / Kaulen, Heinrich (Hrsg.): Literaturkritik heute. Tendenzen – Traditionen – Vermittlung. Göttingen, 267–285.
- Raithel, Jürgen / Dollinger, Bernd / Hörmann, Georg (2009): Einführung Pädagogik. Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen. 3. Aufl. Wiesbaden.
- Staiger, Michael (2022): Kategorien der Bilderbuchanalyse – ein sechsdimensionales Modell. In: Dammers, Ben / Krichel, Anne /Staiger, Michael (Hrsg.): Das Bilderbuch. Theoretische Grundlagen und analytische Zugänge. Stuttgart, 3–27.
- Witzel, Judith: Kinder- und Jugendbuchkritik in überregionalen Feuilletons der Gegenwart. Marburg 2005.
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP und Tagung: Von Neubau zu Plattenbau
Repräsentationen des seriellen Bauens bis Anfang der 1990er Jahre
Termin: 14. bis 16. Mai 2025
Ort: Södertörn Universität/ Stockholm/Schweden
Wie sieht das Wohnen in der Zukunft aus? Können Literatur, Film und Kunst aus der Vergangenheit etwas über Zukunftsmodelle erzählen? Serielle Bauten, Neubauten, Plattenbauten – dies sind nur einige Begriffe, die bauliche Phänomene bezeichnen und Menschen in der Vergangenheit und Zukunft betreffen. Dabei dürfte der Blick insbesondere auf die sog. serielle Bauten interessant sein, die in der DDR als Errungenschaften der Moderne galten und im Westen oft zu Plattenbauen und sozialen Brennpunkten degradiert wurden. Serielle Bauten können aus ökologischer und ökonomischer Sicht ein Wohnen der Zukunft sein aufgrund der Dichte des Wohnens, aber auch aufgrund der Möglichkeit mit Blick auf eine alternde Gesellschaft. Sie bedeuteten auch in der Vergangenheit ein modernes Wohnen – etwa in den Ostseeländern. Einerseits ging es um eine politisch ideologische Ausrichtung, andererseits musste preiswerter Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
Dem seriellen Bauen und Wohnen sind viele Zuschreibungen zu eigen gemacht worden. Diese Zuschreibungen sollen durch die Tagung offengelegt werden. Auf der Konferenz sind historische, soziologische, politikwissenschaftliche, baugeschichtliche, literaturwissenschaftliche und kulturphilosophische Beiträge willkommen, die sich mit dem Plattenbau in Ost und West auseinandersetzen. Beispielsweise könnten folgende Fragen dabei Berücksichtigung finden:
- Wie wird das Wohnen in Neubauten in verschiedenen Medien dargestellt?
- Wie werden sie in der Kunst bis Anfang der 1990er Jahre entfaltet?
- Welche Umbrüche und Kontinuitäten begleiten die Geschichte der Neubauten?
- Welche Akteure werden mit Neubauten/ das Leben in Neubauten in Verbindung gebracht?
- Welche ästhetischen Darstellungsformen von Neubauten gibt es?
Angebote für einen Vortrag erbitten die Veranstalterinnen mit einer knappen Skizze von ca. 300 Wörtern, einer kurzen biografischen Skizze sowie einer ausgewählten Bibliografie mit veröffentlichten Titeln bis zum 22. April 2024 an diese Adresse modularhousing@lnu.se; danach erfolgt eine Rückmeldung bis Mitte Mai.
In einer Themenausgabe der Zeitschrift Baltic Worlds, die in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift herausgegeben wird, können einzelne Artikel der Konferenz veröffentlicht werden. Baltic Worlds ist eine wissenschaftliche, interdisziplinäre Zeitschrift (indexiert in Scopus und Sherpa ROMEO usw.), die vom Zentrum für baltische und osteuropäische Studien der Universität Södertörn herausgegeben wird. Die Zeitschrift ist in gedruckter Form und als Open Access im Internet erhältlich: Baltic Worlds Back Issues. Informationen zur Einreichung und zu den Richtlinien finden Sie unter: Baltic Worlds Einreichung. Die Sprache der Konferenz ist Englisch, die Publikation erscheint ebenfalls in Englisch.
Die Veranstalterinnen bemühen sich um Drittmittel, um Reisekosten zu erstatten.
Die Tagung wird organisiert von: Dr. Astrid Henning-Mohr (Universität Halle, Deutschland), Dr. Lisa Källström (Universität Södertörn, Schweden), PD Dr. Corina Löwe (Linné- Universität, Schweden), Dr. Jana Mikota (Universität Siegen, Deutschland) und PD Dr. Ines Soldwisch (Universität Düsseldorf, Deutschland).
(Quelle: Aussendung)
CfP and Conference: Children’s Literature and European Identities
Time: 24–26th October 2024
Venue: Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
The concept of identity in children’s literature constitutes a multi-faceted phenomenon. Even if it is not explicitly thematised, it often determines the construction of the literary text and its impact on the child reader. It manifests itself in a wide range of aspects, from ideological message through narrative strategies to the choice of language (e.g. hegemonic vs. minority). The identity-forming role of children’s literature is unquestionable: the books people read as children shape them as adults.
The concept of Europe is equally complex, as it has been shaped by geopolitical, ideological, social and cultural changes. The rise and disintegration of empires, the East-West division by the Iron Curtain, and finally, the emergence and transformations of the European Union fostered the coexistence of different projects of transnational thinking. From this perspective, children’s literature can be read as a vehicle for a two-way identity—on the one hand, promoting national identifications; on the other, striving to establish a shared repository of motifs, patterns, and schemes developed through international literary circulation, resulting in more general, European identification.
The theme of identity in children’s literature has already been the subject of scholarly reflection in various European countries (Blažić 2011; Doughty and Thompson 2011; Kelen and Sundmark 2013; Knuth 2012; Krawatzek and Friess 2022, Kümmerling-Meibauer and Schulz 2023; Nordenstam and Widhe 2021; Sheeky Bird 2014; Truglio 2018, etc.). However, research in this field, especially regarding the concept of Europe, needs to be constantly updated and expanded in light of rapidly changing sociological, geopolitical, and cultural realities.
Children’s Literature and European Identities is a pilot conference of the European Children’s Literature Research Network, organised by Children’s Literature & Culture Research Team at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. It is designed as a platform for exploring how different European identities reflect one another, interfere, and interrelate. On the other hand, it will also allow to highlight common patterns and similar elements, and ultimately ask the question about shared European identity.
Topics may include but are not limited to:
- Shared European cultural heritage, its continuations, iterations, and transformations in children’s literature;
- How was/is Europe depicted or represented in children’s literature (geographically, politically, ideologically);
- From the centre to the periphery—the history of European children’s literature in the context of the formation of national identities;
- The canon of children’s literature and shared European identity;
- The impact of translation and translated literature on the construction of local and “shared” identities;
- Postcolonial and post-independence heritage as a “difficult” component of European identities in children’s literature;
- The minority turn—ethnic, linguistic and cultural minorities in literature and book market;
- Identity-forming strategies as a form of emancipation in the field of European children’s literature;
- Migration as an experience triggering the emergence of “identity in motion/process”;
- Representations of Otherness in European children’s literature.
Selected bibliography:
Blažić, Milena Mileva. 2011. Children's Literature in South-East Europe. Comparative Literature and Culture vol. 13.1
Doughty, Terri and Dawn Thompson (eds). 2011. Knowing Their Place? Identity and Space in Children’s Literature. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Kelen, Keith and Björn Sundmark (eds). 2013. The Nation in Children’s Literature. Nations of Childhood. New York: Routledge.
Knuth, Rebecca. 2012. Children’s Literature and British Identity: Imagining a People and a Nation. Lanham-Toronto-Plymouth: The Scarecrow Press.
Krawatzek, Felix and Nina Friess (eds). 2022. Youth and Memory in Europe. Defining the Past, Shaping the Future. Berlin: Walter de Gruyter.
Kümmerling-Meibauer, Bettina and Fariba Schulz (eds). 2023. Political Changes and Transformations in Twentieth and Twenty-first Century Children’s Literature. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Nordenstam, Anna and Olle Widhe (eds). 2021. The Uses of Children's Literature in Political Contexts: Bridging the Pedagogical/Aesthetic Divide. Special Issue of “Children’s Literature” 49.
Sheeky Bird, Hazel. 2014. Class, Leisure and National Identity in British Children’s Literature 1918–1950. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Truglio, Maria. 2018. Italian Children’s Literature and National Identity: Childhood, Melancholy, Modernity. New York: Routledge.
CONFERENCE MODE
The conference will be held in hybrid mode: on-site in the Collegium Maius of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland and on the online platform (MS Teams).
ABSTRACTSUBMISSION
Please submit panel proposals (3 papers) or proposals for individual papers using the attached submission forms to europeanidentities@amu.edu.pl (subject line ChildLit & European Identities Submission) by 30th April 2024.
All abstracts and papers presented at the conference must be in English.
IMPORTANT DATES
Deadline for submission: 30th April 2024
Notification of acceptance: end of May 2024
Deadline for the conference fee payment: 14th June 2024
Provisional programme: beginning of July 2024
CONFERENCE FEES
100 EUR – in-person participation, regular rate
80 EUR – in-person participation, reduced rate (students, PhD students, Precariously Employed)
50 EUR – online participation
CO-CONVENORS:
Magdalena Bednarek
Anna Czernow
Ewa Rajewska
Michalina Wesołowska
Aleksandra Wieczorkiewicz
Children’s Literature & Culture Research Team: www.facebook.com/zespol.dzieciecy
Faculty of Polish and Classical Philology: wfpik.amu.edu.pl/en
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland: amu.edu.pl/en
CfP
Individual Paper Proposal
Panel Paper Proposal
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Kinder- und Jugendliteratur in der DDR und Kanon oder "Was bleibt"
Thematische Zugänge und Einzelanalysen
Termin: 05. bis 07. September 2024
Ort: Universität Potsdam
Auf den bisher zwei Tagungen zur Kinder- und Jugendliteratur in der DDR, die jeweils im September 2022 und 2023 an der Universität Potsdam stattfanden, ging es darum, sich im zeitlichen Abstand der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) in der DDR überhaupt erst wieder zu nähern. Es war betont worden, dass in den 1990er Jahren noch verschiedene Arbeiten zur DDR-KJL erschienen sind (u.a. Dolle-Weinkauff/Peltsch 1990; Gansel 1995, 1997, 1999; Richter 1991, 1995, 1996, 2000; Rouvel 1995). Das wichtige Handbuch zur DDR-Kinderliteratur SBZ/DDR 1945-1990, das von einem Team um Rüdiger Steinlein verantwortet wurde (Steinlein u.a. 2006) sowie das Kapitel „Kinder- und Jugendliteratur der DDR (Dolle-Weinkauff/Peltsch 2008) in der überarbeiteten 3. Auflage der „Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur“ (Wild 2008) bilden gewissermaßen den Abschluss. Seitdem finden sich nur vereinzelt Beiträge zur KJL in der DDR (u.a. Becker 2020, Gansel 2010, 2022, Max 2020, Kümmerling-Meibauer/Meibauer 2021, Roeder 2020, Hernik 2022), die einzelne Aspekte der DDR-KJL in den Blick nahmen. Die Tagungen, an denen auch Autorinnen und Autoren teilnahmen, zielten darauf, Aspekte des Handlungssystems KJL in der DDR einsehbar zu machen und dies nicht zuletzt deshalb, weil das Wissen über die Zusammenhänge in den letzten Jahrzehnten zunehmend verloren gegangen ist. Dies betraf etwa das Profil einzelner Verlage (u.a. Kinderbucherlag, Verlag Neues Leben) wie auch Fragen danach, wie konkret im einzelnen Fall die Druckgenehmigungsverfahren aussahen. Grundsätzlich wurde dabei methodologisch versucht, einem modernisierungstheoretischen Ansatz zu folgen. Dies bedeutet, die Unterschiede in Struktur und Funktion der Literatursysteme in den beiden deutschen Staaten zu berücksichtigen.
Für das Literatursystem DDR ergaben sich entsprechend andere „Funktionssetzungen“, die Literatur übernahm in den ersten Jahren nach Gründung der DDR zunächst – vereinfacht gesagt – „sozialaktivistische Aufgaben“ (Uwe Johnson), und dies betraf sowohl die Allgemeinliteratur als auch die KJL. Mit anderen Worten: Literatur suchte identitätsstiftend, kollektivbildend und gesellschaftslegitimierend zu wirken. Und sie konnte sich dabei in marxistischem Sinne auf reale Veränderungen der sogenannten materiellen Basis berufen (u.a. kein Privateigentum an Produktionsmitteln, daher neues Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen). Dass auf dieser Grundlage – unabhängig davon wie man sie rückblickend einschätzt – andere „Geschichten“ entstanden und entstehen mussten, und das „Was“ und „Wie“ des Erzählens sich von der zeitgleich veröffentlichten Literatur in der Bundesrepublik unterschied, ist erklärlich. Uwe Johnson, der 1959 die DDR verließ, hat entsprechend betont, dass die „Verhältnisse der Geschichte“ die Art und Weise der Darstellung bestimmen. Später brachte er dies auf die Formel: „Die Geschichte sucht, sie macht sich ihre Form selber“ (Uwe Johnson). Von daher erscheint es problematisch, wenn die Suche nach modernen literarischen Techniken einseitig als Maßstab des Erzählens gilt und daher seit den 1950er Jahren allein die „junge deutsche Literatur der Moderne“ (Walter Jens) des Westens zum Gradmesser avancierte. In einer sozialkritisch-realistischen Erzähltradition verankert, suchten Autoren wie Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen, Max Frisch oder Martin Walser, in anderer Weise dann Günter Grass, das Spannungsfeld von „faschistischer Vergangenheit und kapitalistischer Gegenwart“ (Schnell 1986) mit neueren Erzählverfahren zu erfassen. Von solchen Prämissen hob sich die Literatur in der DDR mit Notwendigkeit ab, wenngleich es natürlich auch um die Auseinandersetzung mit Faschismus und Krieg ging, nicht zuletzt in der KJL.
Aus den genannten Gründen soll es nunmehr neben Veränderungen, die das letzte Jahrzehnt in der DDR betreffen, vor allem um eine gründliche Textanalyse gehen. Anders gesagt, nicht eine „vordergründige Einordnung in systemstabilisierende und systemkritische Texte und Autoren“ (Richter 2000) – wie oftmals praktiziert – ist angestrebt, sondern das Herstellen von Zusammenhängen zwischen „exakter Textanalyse“ und den literarischen wie außerliterarischen Kontexten. Ursula Heukenkamp hatte nach dem Ende der DDR betont, dass es darum gehen müsse, sich den „literarischen Texten samt ihren Kontexten“ mit Achtung vor der „Einzelheit und Einmaligkeit der je anderen Zeit“ zu nähern. Dazu gehöre nicht zuletzt, dass es nun um eine „Periode des beinahe positivistischen Sammelns von Sachverhalten gehe“ (Heukenkamp 1991). Diese Forderung ist – zumindest hinsichtlich der KJL in der DDR – weitgehend uneingelöst.
Auf der Tagung soll es daher ausgehend von bestimmten stofflich-thematischen Zugängen um Narratologisches gehen, mithin um „story“ und „discourse“. Ziel ist es, durch konzise Einzelanalysen jene KJL-Texte herauszustellen, die für ihre Zeit Innovatives einbrachten. Damit in Verbindung steht die Frage nach einem möglichen Kanon von Texten der DDR-KJL. Eine solche Frage nach dem Kanon ist immer eine danach, „was bleibt“!? Beim Kanon geht es nämlich um Textmenge, einen Korpus maßgeblicher, bedeutungsvoller Werke. An den ausgewählten Texten lassen sich Gesellschaftsdeutungen, Wirklichkeitserfahrungen, Gefühle, Visionen von Generationen festmachen, ja sie ermöglichen das Gespräch von Menschen, sie fördern Kommunikation, sie erzeugen und sind Ausdruck von Werten (Vgl. Gansel 2002, Korte 2002). Eine solche Verständigung erscheint mit Blick auf die KJL in der DDR überfällig und sollte im Abstand von mehr als 30 Jahren neu geführt werden. Dass dabei in narratologischer Perspektive Figuren-Handlungskonstellationen sowie die jeweiligen Schauplätze ebenso zu hinterfragen sind, steht außer Frage. Die Einzelanalysen ausgewählter Texte können wiederum als Reflex auf gesellschaftliche Modernisierungsphänomene in der DDR betrachtet werden. Von daher ist mitzudenken, dass es ab den 1960er Jahren in der KJL in der DDR – wie auch in der Allgemeinliteratur – einen Wandel gab und es zu einer „ästhetischen Emanzipation“ kam. Vor diesem Hintergrund seien exemplarisch einige mögliche Themenfelder angesprochen und Texte genannt:
- Kinder- und jugendliterarische Texte, in denen es um die Auseinandersetzung mit Krieg und Faschismus sowie die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und den Holocaust geht. In diesem Rahmen ist zu beachten, dass zum Themenfeld „Faschismus und Widerstand“ über die Jahrzehnte bis 1988/89 allein über 200 Texte im Bereich von erzählender Literatur und Sachbuch entstanden sind (Vgl. Dolle-Weinkauff/Peltsch 2008; Hähnel-Mesnard/Schubert 2016). Zu denken ist an Texte wie: Karl Neumann „Das Mädchen hieß Gesine“ (1966); Horst Beseler „Käuzchenkuhle“ (1965); Peter Abraham „Pianke“ (1981) und „Fünkchen lebt“ (1988); Bodo Schulenberg „Markus und der Golem“ (1987); Vera Friedländer „Späte Notizen“ (1982); Gisela Karau „Loni“ (1982); Gerhard Holtz-Baumert „Die pucklige Verwandtschaft“ (1985) und „David – ein glückliches Kind“ (1981); Jürgen Jankowsky „Ein Montag im Oktober“ (1985); Dieter Schubert „O Donna Klara“ (1981).
- Die Neu- und Nacherzählung mythologischer Stoffe sowie älterer Stoffe der deutschen und internationalen Literatur. Dazu gehören: Günter de Bruyn „Tristan und Isolde“ (1975), Franz Fühmann „Das hözerne Pferd“ (1982) und „Prometheus“ (1976); Gerhard Holtz-Baumert „Daidalos und Ikaros“ (1987); Werner Heiduczek „Die seltsamen Abenteuer des Parzival“; (1974); Hannes Hüttner „Herakles“ (1979). Die zwölf Abenteuer“ (1980); Rolf Schneider: „Die Abenteuer des Herakles: Nach alten Sagen neu erzählt“ (1978).
- Texte, die das Reisemotiv nutzen, um aus der „Welt der Gewöhnungen“ zu entkommen: Benno Pludra „Die Reise nach Sundewit“ (1966); Bernd Wolff „Alwin auf der Landstraße“ (1971); Gerhard Holtz-Baumert „Trampen nach Norden“ (1975); Günter Ebert „Mein Vater Alfons“ (1977); Siegfried Weinhold „Stelzenbeins Reise mit dem Onkel“ (1978); Uwe Kant „Die Reise von Neukuckow nach Nowosibirsk“ (1981).
- Eine maßgebliche Rolle spielen Adoleszenzromane, wenngleich diese Gattungsbezeichnung, die in einzelnen Texten mit dem Reise- und Umzugsmotiv verbunden war (Gerhard Holtz-Baumert „Trampen nach Norden“, 1975; Rolf Schneider „Die Reise nach Jaroslaw“, 1974) nicht verwendet wurde (Gansel 1999, 2004, 2011; Fernández Pérez 2022, Hernik 2022). Systemprägend wirkte in diesem Zusammenhang Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W.“, 1972). Es folgten wichtige Texte wie Gunter Preuß „Tschomolungma“ (1981); „Feen sterben nicht“ (1987); Günter Görlich „Das Mädchen und der Junge“ (1981). Ein frühes Beispiel war Joachim Wohlgemuths „Egon und das achte Weltwunder“ (1962), auch Karl Neumanns erfolgreiche Trilogie „Frank“ (1958), „Frank und Irene“ (1964) und „Ulrike“ (1974) gehören in diesen Kontext. Zahlreiche Texte, die von Jugend bzw. Adoleszenz erzählten, wurden sodann in der extra eingerichteten „Neuen Edition für junge Leute“ im Verlag Neues Leben publiziert. In diesem Rahmen steht die Frage danach, ob es in der DDR-KJL eine „Mädchenliteratur“ gegeben hat bzw. in welcher Weise sich die Texte, in denen Mädchen im Zentrum standen, in ihrer Modernität von der zeitgleichen Literatur in der Bundesrepublik unterschieden.
- Beim Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der KJL in der DDR und der BRD ist auch die sogenannte Abenteuerliteratur zu nennen, die in der DDR auf „Authentizität und nichtrassistische Darstellung“ (Dolle-Weinkauf/ Peltsch 2008) zielte. Hierzu zählen Ludwig Renns „Trini“ (1954) wie auch die später von der DEFA verfilmten Romane von Lieselotte Welskopf-Henrich über den Kampf der Dakota in Nordamerika (u.a. „Die Söhne der großen Bärin“, 1951 ff.) In anderer Weise wird die Auseinandersetzung um Schuld im Dritten Reich mit einer abenteuerlichen Handlung in Horst Beselers Roman „Käuzchenkuhle“ (1964) verflochten, der über Jahrzehnte zum Kanon des Deutschunterrichts gehörte.
- Die sogenannte „Umzugsliteratur“, zu der Texte gehören, in denen die jugendlichen Helden durch Mobilitätsanforderungen sich unter veränderten örtlichen Verhältnissen zurechtfinden müssen (Günter Görlich: „Den Wolken ein Stück näher“ (1971); Edith Bergner „Das Mädchen im roten Pullover“ (1974); Benno Pludra „Insel der Schwäne“ (1980); Joachim Nowotny „Der Riese im Paradies“ (1969) und „Abschiedsdisko“ (1981).
- Eine gesonderte Rolle spielten seit den 1970er Jahren KJL-Texte, in denen es um Fragen nach dem Verhältnis zur Natur und Umwelt geht. Dazu gehören: Horst Beseler „Die Linde vor Priebes Haus“ (1970) und „Tiefer Blauer Schnee“ (1976); Bernd Wolff „Biberspur“ (1979); Kurt David „Antennenaugust“ (1975) und vor allem die Bücher von Wolf Spillner “Wasseramsel“ (1984) und „Taube Klara“ (1988). Die Auflistung von thematischen Zugängen könnte fortgesetzt werden. Als Grundsatz für die Auswahl der ins Auge gefassten Texte sollte nolens volens die Frage nach der literarischen Qualität stehen. Es geht also letztlich um den Versuch, einen Kanon der DDR-Kinder- und Jugendliteratur zu entwerfen, der seine Grundlage in konzisen Einzelanalysen findet. Was ausdrücklich nicht angestrebt ist, das sind Darstellungen, von denen der Historiker Jürgen Kocka sagt, dass ihre „moralisch-politischen Urteile der Gegenwart relativ ungefiltert auf die Interpretation der DDR-Geschichte“ (Kocka 1993) und ihrer Literatur durchschlagen.
Die genannten Aspekte verstehen sich als Rahmen für Beitragsvorschläge. Weitere Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. Die Veranstalter erbitten kurze Abstracts und Informationen zum CV (ca. 15 Zeilen) bis zum 31. März 2024 an folgende Anschriften:
- Prof. Dr. Carsten Gansel Justus-Liebig-Universität Gießen FB 05 Sprache, Literatur, Kultur Germanistisches Institut Otto-Behaghel-Str. 10B 35394 Gießen carsten.gansel@germanistik.uni-giessen.de
- Dr. Monika Hernik Universität Potsdam Universitätscampus II Golm Haus 16, Raum 2.05 Karl-Liebknecht-Str. 24-25 14476 Potsdam OT Golm hernikmlodzianow@uni-potsdam.de
- Dr. José Fernández Pérez Justus-Liebig-Universität Gießen FB 05 Sprache, Literatur, Kultur Germanistisches Institut Otto-Behaghel-Str. 10B 35394 Gießen jose.fernandez-perez@germanistik.uni-giessen.de
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP Sammelband
Sommerferien in der Kinder- und Jugendliteratur
Insbesondere Sommerferien sind ein zentrales Thema in der Kinder- und Jugendliteratur, was aber bislang in der Forschung weder diachron noch synchron reflektiert wurde. Dabei lässt sich diese temporäre Phase als ein Schwellen-, Übergangs-, Imaginationsraum sowie Nicht-Ort fassen, denn einerseits ist es eine fast schwerelose, unbekümmerte Zeit, andererseits ist sie mit zahlreichen Veränderungen verbunden. Diese deuten sich insbesondere im Übergang von Kindheit zur Jugend an, die Akteur:innen erleben am ersten Schultag, wie sich Freund:innen verändert haben und Kindheit abgeschlossen wurde. Ferien können aber auch mit Kummer, Langeweile und Ausgrenzung beginnen, wenn Sommerfahrten nicht möglich sind, was sich jedoch auch ändern kann. Denn: Sie können voller fantasievoller und überraschender Abenteuer in Gärten, Wäldern und Straßen der Heimat der Zuhausegebliebenen sein. Egal, wie die Akteur:innen ihre Ferien verbringen, sie sammeln Erfahrungen, verändern sich und kehren anders zurück.
In Busfahrt mit Kuhn heißt es bspw.: „Wir spielen schöne Zeit, wir spielen Ferien. Wir spielen noch einmal Frühstück bei Ben.“ (Bach 2007, 48) Ferien scheinen hier mit Kindheit und Freiheit verbunden zu sein. Sommerferien können daher auch als Phase des Dazwischens bezeichnet werden (vgl. Stemmann 2022).
Der anvisierte Sammelband möchte die Sommerferien in (v.a., aber nicht nur deutschsprachigen) kinder- und jugendliterarischen Texten in den Fokus rücken. Beispielsweise könnten folgende Fragen dabei Berücksichtigung finden:
- Welche Bedeutung haben Sommerferien in der Jugendliteratur?
- Unterscheidet sich diese von der Kinderliteratur?
- Inwiefern parallelisieren Sommerferien Übergangs- und Reifungsprozesse der Pubertät?
- Nehmen Sommerferien-Erfahrungen in der Jugend das Erwachsenenwerden vorweg?
In die Beiträge soll jeweils auch eine literaturdidaktische Perspektive mit einbezogen werden: Unter welchem Blickwinkel kann es gelingen, Erzählen über diese besondere Zeit in die Schule zu holen – und wie kann Unterricht dabei so gestaltet werden, dass Heranwachsende mit unterschiedlichen sozioökonomischen Voraussetzungen und unterschiedlichen persönlichen Vorerfahrungen dabei gleichermaßen Berücksichtigung finden?
Neben Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur wie zahlreiche Romane von Astrid Lindgren oder Enid Blyton seien zum Beispiel Kirsten Boies Sommerby-Romane, Will Gmehlings Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel oder ganz aktuell Wolf von Saša Stanišić genannt. Überblicksbeiträge zu ausgewählten Autor:innen und aus dem weiten Feld der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur sind ebenfalls willkommen.
Die fertiggestellten Beiträge sollen sich i.d.R. mit einem Kinder- oder Jugendbuch bzw. einem anderen jugend- bzw. kinderliterarischen Medium auseinandersetzen und bis zum Ende der Sommerferien (15. September 2024) vorliegen.
Die Gliederung der Beiträge soll einheitlich sein:
- kurze Inhaltsangabe/Textvorstellung mit Ausführungen zur angezielten Jahrgangsstufe
- knappe literaturwissenschaftliche Analyse (im Hinblick v.a. auf den Schwerpunkt des Bandes, z.B. hinsichtlich einer Raumsemantik, der Erzählperspektive(n), stilistischer Besonderheiten)
- didaktischer Kommentar I: Beschreibung des allgemeinen literaturdidaktischen Potentials
- didaktischer Kommentar II in Bezug auf das Thema/Motiv Sommerferien
- didaktisch-methodische Konkretisierungen
Angebote für einen Beitrag erbitten wir mit einer knappen Skizze von ca. 300 Wörtern sowie einer kurzen biografischen Skizze bis zum 1. März 2024; danach erfolgt eine Rückmeldung bis Mitte März zu möglichen Beiträgen. Die Vorschläge sind zu richten an:
Dr. Ines Heiser: ines.heiser@uni-marburg.de
Dr. Jana Mikota: mikota@germanistik.uni-siegen.de
Andy Sudermann: andy_sudermann@web.de
Die Publikation des Bandes ist in der Reihe „Kinder- und Jugendliteratur. Themen – Ästhetik – Didaktik“ (hg. von Prof. Dr. Jan Standke) im Verlag Beltz Juventa vorgesehen.
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Herbstseminar 2024
"Literatur braucht Raum!" – für eine lebendige Lesekultur für junge Menschen
Termin: 15. bis 17. November 2024
Ort: Exerzitienhaus Himmelspforten, Würzburg
Literatur ist ein Raumwunder; ein einziges Buch fächert ganze Welten auf, in die die Lesenden eintauchen, die sie berühren und sie prägen. Fiktive Räume werden zu Fixpunkten unserer inneren Topografie. Aber wie steht es um den Raum, den Literatur selbst für sich beanspruchen darf? Vor allem im Leben von Kindern und Jugendlichen, in Bildungseinrichtungen ebenso wie in der Familie und in der Freizeit?
Die dramatischen Befunde jüngster Leseleistungsstudien zeigen, dass am Ende der Grundschulzeit jedes vierte Kind nicht sinnentnehmend lesen kann. Diesen Kindern bleiben damit nicht nur bereichernde Literatur-Erfahrungen verwehrt, sondern auch das Recht auf Chancengerechtigkeit und aktive Teilhabe in der Gesellschaft.
Der Arbeitskreis für Jugendliteratur fordert daher, den Anspruch auf Bildung für alle zu stärken. Auch für Benachteiligte, Bildungsferne, Sprachferne. Für die Leseförderung heißt das: Es braucht Raum und Zeit für die Begegnung mit Büchern und Texten, fächerübergreifend, über die gesamte Kindheit und alle Lebensbereiche hinweg.
Die Tagung „Literatur braucht Raum!“ will anhand innovativer Ansätze aufzeigen, wie und wo eine lebendige Lesekultur für junge Menschen Realität werden kann – sei es analog oder digital. Forschungsergebnisse, Modellvorhaben und Erfahrungen aus der Praxis fließen gleichermaßen in das Tagungsprogramm ein.
Folgende Aspekte sollen betrachtet werden:
Leseförderung braucht Raum und Ressourcen!
Mangelnde Lesefähigkeit von Kindern und Jugendlichen, Petitionen und Bedarfe in der Praxis VERSUS finanzielle Sparzwänge, Personalmangel, Etatkürzungen, Bibliotheks- und Buchhandlungssterben. Was braucht es für eine effiziente, gerechte und flächendeckende Leseförderung? Welche Ansätze sind besonders wirkungsvoll, welche Modellprojekte haben sich bewährt?
Begegnungsorte – Bildungsräume
Rund 7.000 Kinder- und Jugendbücher erscheinen hierzulande jährlich. Wie und wo erreichen sie ihre Leser:innen, wo entstehen anregende Lebens- und Lesewelten? (Kita – Bibliothek – Buchhandel – Schule – Literaturhaus – Theater – Museum – öffentlicher Raum – Outdoor) Wie sollten Bildungsräume gestaltet werden? Wie können dortige Angebote inklusiver werden, um u.a. auch Bildungsferne anzusprechen? Und wo findet literarische Wertung statt?
Raum als narratologisches Konzept
Literatur ist zumeist räumlich verortet; sie kartografiert fiktionale Schauplätze oder schafft neue Zugänge zu realen Orten. Räume werden in Szene gesetzt und laden Leser:innen ein, sich selbst auf Erkundungstouren zu begeben.
Literatur im digitalen Raum
Booktok, Bookstagram, Fanfiction, Podcasts, Wattpad. Der digitale Raum bietet Portale und Formate, über die neue Zielgruppen erschlossen und teils hohe Reichweiten erzielt werden. Wie kann die Kinder- und Jugendliteratur davon profitieren? Und weiß der etablierte Literaturbetrieb diese Plattform für sich zu nutzen?
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Vermittler:innen von Kinder- und Jugendliteratur aus den Bereichen (Literatur-)Pädagogik, Bibliothek, freie Jugendarbeit, Buchhandel, Forschung, Journalismus sowie an Autor:innen, Illustrator:innen, Übersetzer:innen und Mitarbeitende in Verlagen.
Mögliche Formate:
- Hauptvortrag (45 Minuten),
- Kurzvortrag (30 Minuten),
- Workshop (ca. 3 Stunden)
- Lesung / Werkstattbericht
Abstracts, max. 1.500 Zeichen:
Neben einer Inhaltsskizze zu einem der oben genannten Aspekte bitten wir um einen Arbeitstitel, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund).
Einsendeschluss: bis 29. Januar 2024 an bernd@jugendliteratur.org
(Quelle: Aussendung)
CFP for Edited Collection
"Drawing Protest: Graphic Narratives for Youth and Social Justice"
Co-edited by Michelle Ann Abate and Frederick Luis Aldama
Graphic narratives have emerged as one of the most popular and rapidly growing genres of books for young readers. They have also become a rich and vibrant platform for authors to engage with issues of social justice. Many of the most critically acclaimed as well as commercially popular graphic texts over the past decade—March, El Deafo, American Born Chinese, to name just a few—address issues of prejudice and discrimination.
This edited collection will examine how graphic narratives for young people engage with socio-political issues related to diversity, equity, inclusion, and belonging. To that end, we invite chapter proposals about texts that address a broad range of topics and concerns within social justice, including racism, disability, homophobia, displacement, refugees, transphobia, classism, mental health, xenophobia, addiction, war, poverty, and climate change. Essays may consider a wide array of literary schools and narrative styles, including fiction, nonfiction, and memoir. Additionally, focal texts are not limited to any specific grade level, age range, or youth audience; considerations of narratives intended for elementary-grade readers through young adults are welcome. Finally, discussions that consider the cultural pushback that most (if not all) of these graphic narratives have experienced—both because of their use of a comics mode of storytelling and because of their focus on social justice—are also encouraged.
Chapters might explore broad theoretical questions, which include—but are not limited to—the following:
- In what ways can such texts serve as tools for raising awareness, fostering empathy, and enacting social change?
- How have these books been inspired by existing social justice movements—and in what ways can they be regarded as inspiring such efforts?
- What role have graphic narratives that engage with issues of social justice played in the evolution of children’s and young adult literature as well as that of sequential art?
- How do we reconcile the use of graphic narratives as an engine for social change in the twenty-first century with the fact that comics were, for much of the nineteenth and twentieth centuries, a platform for racist caricature, homophobic humor, sexist imagery, ableist ideology, and xenophobic stereotypes?
Additionally, chapters might also focus on specific title(s). A list of possibilities is below:
- John Lewis, Andrew Ayden, and Nate Powell, March (2013)
- Gene Luen Yang, American Born Chinese (2006)
- Cece Bell, El Deafo (2014)
- Rachel Hope Allison, I’m Not a Plastic Bag (2012)
- Thi Bui, The Best We Could Do (2017)
- Jerry Craft, New Kid (2019)
- George Takei, They Called Us Enemy (2019)
- Maia Kobabe, Gender Queer (2019)
- Jarrett Krosoczka, Hey, Kiddo (2018)
- Raina Telgemeier, Drama (2012)
- Frank Abe, Tamiko Nimura, and Ross Ishikawa, We Hereby Refuse (2021)
- Tommie Smith, Derrick Barnes, and Dawud Anyabwile, Victory Stand!: Raising My Fist for Justice (2022)
- Malaka Gharib, I Was Their American Dream (2019)
- G. Willow Wilson and Adrian Alphona, Ms. Marvel (2014)
- Olivier Kugler, Escaping Wars and Waves: Encounters with Syrian Refugees (2018)
- Art Spiegelman, Maus (1980)
- Jason Reynolds, Miles Morales: Spider-Man (2017)
- Marjane Satrapi, Persepolis (2000)
Please send chapter proposals of 300 words maximum by January 28th, 2024 to GraphicNovelsSocialJustice@gmail.com.
Editorial decisions will be conveyed by March 1, 2024.
Full-length essays of 6,000 to 8,000 words will be due by August 1st, 2024.
The co-editors have received an advanced contract for the collection from the University Press of Mississippi. A formal book proposal will be submitted after proposals have been accepted and a Table of Contents has been constructed. The co-editors will convey feedback from the outside evaluators while contributors are working on the initial drafts of their essays.
(Quelle: IRSCL International Research Society for Children's Literature - Facebook)
CfP und Tagung: Aufgezeichnetes Erbe
Kulturelle Interferenzräume des östlichen Europa als Sujet im Comic
Termin: 7. und 8. November 2024
Ort: Universität Oldenburg
Der jahrzehntelang als trivial verrufene Comic erlebt seit einigen Dekaden in Deutschland eine Konjunktur, die neben der wachsenden Präsenz auf dem Buchmarkt in Feuilletons, Museen, auf Festivals und Internetforen ebenso ablesbar ist wie in der Forschung und Lehre. Zunehmend ist dieser Aufschwung auch in Narrativen über das östliche Europa zu verzeichnen, was insbesondere für Kriegskinder und -enkel:innen gilt, die ihr oder ein sehr unterschiedlich gestaltetes ‚Erbe‘ aus dem 20. Jahrhundert und darüber hinaus aufzeichnen. Hierbei trägt vor allem die dem Comic, der Graphic Novel oder allgemein der grafischen Literatur inhärente Hybridität von verbaler und bildlicher Sprache zu einem vielfältigen Nachzeichnen von Geschichte(n) bei. Ebenso abstrakt wie konkret, teils dokumentarisch, teils fiktiv werden mit dem ‚Redrawing‘ auch Leerstellen, Marginalisiertes und Unbekanntes erfasst.
Anders als in rein verbalen Erzählungen, deren lineare Abfolgen zur Chronologie tendieren, neigt die Bildebene im Comic zu einem nichtlinearen Verhältnis zur Zeit. Zum einen lassen sich Bilder – wenn auch nicht notwendigerweise – leichter erfassen als ein Text, zum anderen sind Panels zugleich neben- und untereinander positioniert oder im unterschiedlichem Maße aufgebrochen. So können auf einer Seite oder in einem Panel Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft koexistieren, korrespondieren und kollidieren. Die literarische Polyphonie (Michail Bachtin) erweist sich hierbei als Polygrafie, die Varianten von Geschichte(n) ins Bild setzt, ihre ‚Gemachtheit‘ aufzuzeigen vermag und gegebenenfalls affirmativ oder subversiv kommentiert. Eben diese Vielfalt entspricht den einst multiethnischen Blickwinkeln in östlichen Regionen sowie (auto-)biografischen Perspektiven von Nachgenerationen. Mitunter gilt dies auch für Zeitzeug:innen der Shoah, des Zweiten Weltkriegs sowie von Umsiedlungen, Flucht und Vertreibungen, die Zeichnungen und Comics etwa als Lagerinhaftierte oder unterwegs in den Kriegswirren anfertigten. Offenbar werden hierdurch neuartige Verflechtungen und Verbindungen sowie Verletzungen – in testimonialen Fällen sogar aus erster Hand.
Ähnlich wie in der Shared Heritage-Literatur[1] fällt in den grafischen Skizzen und Ausarbeitungen eine Vielzahl von Familiengeschichten, aber auch (Reise-)Reportagen, Dokumentationen und (Kriegs-)Tagebüchern auf, bei denen gerade die Nachgenerationen explizit spekulieren. Längst hat sich der Comic als Erinnerungsmedium profiliert, in dem insbesondere das Fragmentarische, die Last und auch die Latenz des Erbes intermedial zum Ausdruck kommen. Dessen Autor:innen leben ebenso im deutschsprachigen Raum wie etwa in Polen, Litauen, Serbien, Russland, Tschechien, der Ukraine oder Ungarn; hinzu kommen Künstler:innen, die aus dem östlichen Europa stammen oder dort familiäre Wurzeln besitzen, zwischenzeitlich jedoch in deutschsprachigen Ländern wirken. Zu solchen Comicschaffenden, die teils selbst zeichnen, teils mit Illustrator:innen zusammenarbeiten, gehören Agata Bara, Tomasz Bereźnicki, Jan Blažek, Lina Itagaki, Jaromír 99, Reinhard Kleist, Oxana Matiychuk, Monika Powalisz, Jaroslav Rudiš, Bianca Schaalburg, Marek Toman, Birgit Weyhe und Barbara Yelin.
Die geplante Tagung will die grafisch-textuellen Rekonstruktionen eines gemeinsamen (Kultur-) Erbes, dessen Details oft verschüttet sind, untersuchen. Dabei soll der aus der Architekturgeschichte und Denkmalpflege kommende Begriff Shared heritage auf eine Literatur übertragen werden, deren grafische Elemente gerade die materielle Dimension des (Kultur-)Erbes ab- und nachbilden.
Dementsprechend stellen sich u.a. folgende Fragen:
- Welche Funktionen kommen den grafischen Aspekten und ihrer narrativen Einbindung zu? Welche Einsichten oder Erkenntnisse bietet das Wechselverhältnis von Bild und Text – auch im Vergleich zu rein literarischen Erzählungen?
- Fotovorlagen oder fotografische Collagen sind gängige Comicverfahren. Inwiefern dienen diese einer Zeugenschaft und inwiefern kommt dem Comic überhaupt einZeugnispotential zu? Wie konstruieren die grafischen Erzählungen ‚Authentizität‘?
- Inwiefern ist der Comic ein Erinnerungsmedium? Inwiefern erweist er sich gerade für Autor:innen aus dem östlichen Europa bzw. für Autor:innen, die über diese Region schreiben, als so attraktiv?
- Wie werden (Auto-)Biografisches und Familiengeschichten erzählt und ins Bild gesetzt? Auf welche Weise erfolgen Distanzierungen, Annäherungen und Einbindungen?
- Welche Rolle spielt dabei die Erinnerung an eine ‚Kindheit‘? Und welche Kindheitskonzepte werden in Kombination mit der Erinnerungsarbeit konstruiert?
- Wie wird der Comic zum Shared Heritage als (vermeintlich) popkulturelles Medium geschichtspolitisch und/oder didaktisch eingesetzt?
- Inwiefern wird im handwerklich geprägten Comic das digitale Hyper-Archiv aufgegriffen?
- Wie positionieren sich diesbezüglich die digital sozialisierten Nachgenerationen?
Die Veranstalter:innen laden Literaturwissenschaftler:innen verschiedener Fächer (wie Germanistik, Interkulturelle Germanistik, Komparatistik, Slavistik, Medienwissenschaft) zur Mitwirkung in Form eines Vortrages ein. Die Redezeit beträgt ca. 30 Minuten; Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Eine spätere Publikation ist geplant. Die Kosten für die Unterkunft der Referent:innen werden erstattet.
Bitte senden Sie Ihr Vortragsexposé (2.000 Zeichen), einen kurzen Lebenslauf mit E-Mail und Postanschrift sowie Angaben zu Ihrer derzeitigen Tätigkeit (max. 1000 Zeichen) bis zum 15.02.2024 an: silke.pasewalck@bkge.uni-oldenburg.de.
Bei der Tagung handelt es sich um eine Kooperation der Universitäten Łódź (Polen) und Oldenburg mit dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Sie ist Teil der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse (KIBUM) und wird organisiert von Prof. Dr. Thomas Boyken, Prof.'in Dr. Gudrun Heidemann und Dr. Silke Pasewalck.
[1] Vgl. Shared Heritage. Gemeinsames Erbe. Kulturelle Interferenzräume im östlichen Europa als Sujet der Gegenwartsliteratur. Hg. von Silke Pasewalck. Berlin-Boston: De Gruyter Oldenbourg 2023 (im Erscheinen).
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP und Workshop: Ein neues Kapitel?
Jüdische Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum nach 1945
Termin: 18. und 19.03.2024
Ort: Universität Bremen
Als Literatur einer gesellschaftlichen Minorität befand sich die jüdische Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum stets in einem Spannungsverhältnis zur Literatur der Mehrheitsgesellschaft, neben und mit der sie eine unsichere Position im literarischen Produktionsfeld einnahm. Dies spiegelt auch das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden wider, das in diachroner Perspektive "nahezu durchgängig von Spannungen, Misstrauen, im besten Fall von Ignoranz und Gleichgültigkeit, vielfach jedoch von extremer Gewalt" geprägt war (Glasenapp 2021: 52). Dass sich unter diesen Bedingungen im 19. Jahrhundert dennoch eine belletristische Kinder- und Jugendliteratur entwickeln konnte, die sich an ein dezidiert jüdisches Publikum richtete und schließlich im 20. Jahrhundert zu einem nach unterschiedlichen innerjüdischen Strömungen und Positionen aufgefächerten Lektüreangebot wurde, ist seit den 1990er Jahren von der Literaturwissenschaft intensiv aufgearbeitet worden.
Die Shoah stellt einen Bruch in dieser Entwicklung dar, der die jüdische Kinder- und Jugendliteratur bis heute prägt, bedeutete jedoch keinesfalls das Ende der Publikation und des Schreibens für jüdische Kinder und Jugendliche. Auch nach 1945 erschienen, zunächst vereinzelt, Schriften, die an jüdische Kinder und Jugendliche (mit)adressiert waren oder jüdische Themenkomplexe verhandelten. Während in der Schweiz seit den 1980er Jahren vorwiegend religiöse Literatur verlegt wurde, die sich an ein exklusiv jüdisches Publikum richtete, begann in den 2000er Jahren u.a. mit der Auszeichnung von Holly-Jane Rahlens Jugendroman Prinz William, Maximilian Minsky und ich (2002, DJLP 2004) eine Entwicklung, die einerseits durch ein zunehmendes Interesse des kinderliterarischen Systems an jüdischen Themen und Autor:innen geprägt ist und gleichzeitig durch einen Anstieg der Produktion in Form von Verlagsgründungen (Ariella Verlag 2010), Kinderbuchlinien mit jüdischem Profil (Hentrich & Hentrich, Jüdische Verlagsanstalt, Lichtig Verlag) oder Veröffentlichungen in etablierten Verlagen.
Der geplante Workshop fokussiert die Entwicklung jener jüdischen Kinder- und Jugendliteratur, die nach 1945 im deutschsprachigen Raum erschienen ist. So soll u.a. der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise sich nach dem Bruch der Shoah jüdisches Schreiben für Kinder wieder neu konstituierte, auf welche Weise diese Disruption, gegebenenfalls aber auch die Kontinuität zur Vorkriegstradition sich in die Texte einschreibt und auf welche Weise sie jüdische Identitäten konstruieren. Die Kinder- und Jugendliteratur zur Schoah ist so umfangreich, dass sie nicht nur als eigenes Genre gefasst werden kann, sondern zuweilen der (unrichtige) Eindruck entsteht, es handele sich um ein Korpus, das mit dem der sog. jüdischen Kinder- und Jugendliteratur weitgehend deckungsgleich sei. Dieser Fehlkonzeption tritt der Workshop entschieden entgegen. Stattdessen soll der Rolle der Schoah im Schreiben für jüdische Kinder nachgegangen werden – sowohl als thematischer Fokus z.B. eines intergenerationalen Gesprächs (Eva Lezzi: Beni, Oma und ihr Geheimnis, Monika Helfer/Michael Köhlmeier: Rosie und der Urgroßvater), wiederkehrendes Dilemma deutsch-jüdischer Begegnungen, als unerzählbare Leerstelle und schließlich als Folie, vor der die Produktion einer neuen jüdischen Kinderliteratur stattfand. Auch mit Blick auf weitere Themenfelder soll an neuere Forschungen angeschlossen werden, die jüdische Kinder- und Jugendliteratur mit Blick auf Genderkonstruktionen sowie postsowjetische und/oder postmigrantische Positionen sowie deren Status als transkultureller Literatur untersuchen.
Neben den bereits skizzierten Themenfeldern sind für den Workshop u.a. folgende Themen von Interesse:
- Produktionsbedingungen jüdischer KJL im deutschsprachigen Raum: Entwicklungen in Österreich und der Schweiz sowie den beiden deutschen Staaten, Renaissance ab den 2000er Jahren
- Genreentwicklungen nach 1945: u.a. Märchen, Kinderbibel, Adoleszenzroman in ihrer literaturhistorischen Entwicklung, fantastisches und realistisches Erzählen
- Religiöse und säkulare Positionen in der KJL: Normalität, Störung und Dissens
- Reflektionen gesellschaftlichen Wandels in der jüdischen Kinder- und Jugendliteratur: Nachkriegszeit, Wende, Veränderung der Gemeindestrukturen in den 1990er Jahren, Zuzug sog. „Kontingentflüchtlinge“ aus den Staaten der ehem. Sowjetunion
- Die Rolle von Neuauflagen und Übersetzungen
- Jüdisches Schreiben – schreiben (nur) für ein jüdisches Publikum? Poetik jüdischer Autor:innen
- Deutsch-jüdisch, deutsch/jüdisch, deutsch oder jüdisch? Konfigurationen des Verhältnisses von Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Selbstverortung in der Literatur, Auseinandersetzung mit der „Tätergesellschaft“
- Postsowjetische und postmigrantische Positionen in jüdischer KJL
- Jüdische Sachliteratur und Sachliteratur über das Judentum
- Jüdische Adoleszenz nach 1945 als Auseinandersetzung mit einer nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft
Neben den Einzelreferaten soll der Workshop Gelegenheit zur gemeinsamen Arbeit am Text liefern. Darüber hinaus soll am zweiten Tag Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, sich in einem Netzwerk künftig weiter miteinander zu verbinden. Die Ergebnisse sollen in einem Tagungsband publiziert werden. Interessierte sind eingeladen, bis zum 31.01.2024 ein kurzes Abstract (300 Wörter) an ha_st@uni-bremen.de zu schicken.
Organisation: Dr. Hadassah Stichnothe (Universität Bremen)
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP und Tagung: "Deutschsprachige Kinder- und Jugendlyrik – unerforscht, unterplatziert und unterschätzt"
Termin: 7. bis 9 November 2024
Ort: Universität Siegen, hybrid
Der wenig präzise Begriff 'Kinderlyrik' verführt immer wieder dazu, neue Gliederungen zu versuchen. Selbst unter der Voraussetzung, dass sich der Textbestand von dem der Erwachsenenlyrik stark unterscheidet, scheint der Versuch, Kinderlyrik zu systematisieren, bis heute nur sehr unzureichende Ergebnisse zu zeitigen. Mit Blick auf die aktuelle Kinderlyrik erscheint es mehr als geboten, neue Aspekte aufzuzeigen. Dasselbe gilt für die deutschsprachige Jugendlyrik. Neuere Entwicklungen wie die Instagram-Lyrik, der Versroman für junge Leser:innen, mehrsprachige Dichtung in leichter Sprache oder mehrsprachige Gedichte sowie Deutschrap oder Spoken Word in Soziolekten sind bisher nicht ansatzweise von der Forschung aufgegriffen worden. Aber selbst da, wo es sich um vermeintlich „sicheres“ Gebiet handelt, nämlich der Vermittlung von als zugänglich betrachteten kanonisierten Gedichten von Goethe bis Kaléko, ist festzustellen, dass der Korpus unbefriedigend ist. So wird zum Beispiel die Kinderlyrik der DDR oder „Gastarbeiterkinderlyrik“ bis heute fast vollständig ausgeblendet. Insbesondere aus universitären Kontexten und aus Gesprächen mit Lehrkräften ist bekannt, wie schwer es Lyrik aktuell hat. Gedichte werden oft als zu schwierig betrachtet, die nach einem Schema analysiert werden müssen. Dabei ist besonders die aktuelle Kinderlyrik vielfältig und bietet für heterogene Lernkontexte ein großes Potential. Was allerdings auch klar wird: Oftmals ist den Lehrkräften weder die Bedeutung der Lyrik bewusst noch wissen sie, wo sie nach Gedichten suchen können. Daher möchte die Tagung gerade auch diesen Zustand in den Blick rücken und konkret Literaturvermittler:innen ansprechen. Kinder- und Jugendlyrik ermöglicht wie keine andere Textsorte, kein anderes Genre sprachästhetische Erfahrung (Liede, 1963, S.12 ff.). Dennoch hat es die Kinder- und Jugendlyrik schwer, nicht nur in schulischen Kontexten, sondern auch Verlage scheuen sich Lyrik zu publizieren. Dabei erschaffen gerade sprachästhetische Zugänge die Möglichkeit, uns für etwas Neues zu öffnen.
Die Tagung möchte den IST-Zustand reflektieren, aber nicht nur klagen, sondern konkret über Verbesserungen nachdenken. Daher existieren unterschiedliche Sektionen, die diese Fragen reflektieren und vor allem auch Mut machen, sich mit Lyrik zu beschäftigen.
Zu folgenden Sektionen können Abstracts eingereicht werden:
- Literaturwissenschaftliche und historische Perspektiven
- Lyrik und Bild
- Lyrik und Sprache
- Literaturdidaktische Perspektiven / Lyrik in der Schule
- Lyrik in außerschulischen Kontexten
- Institutionen und Literaturpreise
Angebote für einen Vortrag werden mit einer knappen Skizze von ca. 300 Wörtern sowie einer kurzen biografischen Skizze bis zum 15. Januar 2024 erbeten, danach erfolgt eine Rückmeldung bis Ende Januar zu möglichen Vorträge. Die Vorschläge können an Prof. Dr. Sandra Niebuhr-Siebert (S.Niebuhr-Siebert@hchp.de), Dr. Jana Mikota (mikota@germanistik.uni-siegen.de) und Dr. Nadine J. Schmidt (schmidt@germanistik.uni-siegen.de) geschickt werden. Die Tagungsorganisatorinnen bemühen sich um Rückerstattung der Fahrkosten.
Organisation: Dr. Jana Mikota, Prof. Dr. Sandra Niebuhr-Siebert, Dr. Nadine J. Schmidt, Nils Mohl, Dr. Uwe-Michael Gutzschhahn
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP: Children's Literature in Times of War
CfP: Children's Literature in Times of War
During the war, hardly any of the institutions of the nations involved are left untouched, and literature is no exception. There are two ways in which a war can affect literary production and literary content. First, one can expect a shift in the priorities and values of the society and the state during a military conflict. Non-military expenses may be cut, propaganda becomes central, and writers and publishers have to respond. Second, a recently ended war may form a part of the national historical narrative. National literature often takes on the task to elaborate and to disseminate this narrative. Focusing on education, socialization, and indoctrination, as children’s literature is wont to do, makes the latter a medium that is especially apt to answer both wartime and post-war challenges of the war.
Arguably, post-war literary representations of the war have generally been a more extensive phenomenon and definitely attracted much more attention from researchers. When working with representations of war in works for children, scholars primarily discuss the way the heroes, enemies and victims of war are depicted. Dozens of monographs and articles have been devoted to these topics. In most cases the subject is a post-war artistic reflection undertaken with the aim of conveying public consensus in assessing the past war (e.g. Zur 2010, The Representations 2014, Tan, Nelson 2022).
The transformation of children’s literature in wartime has been studied only sporadically and proved harder to understand. Our first question here is: to what extent and how exactly did the content of children’s literature change in wartime? Indeed, most of the research on the content of wartime children’s literature discusses its propaganda potential (Agnew, Fox 2001, Paris 2004; Marten 2012; Olivier-Messonnier 2012; Darr 2012; Paul, Johnston, Short 2016; Budgen 2018; Zunino 2019). However, some studies, by focusing on the entire body of children’s literature published during the war period, were able to show that its content could distance itself from pure military propaganda (Galway 2022). The issue of wartime censorship has also received some attention (e.g., Benner 2015; Sinibaldi 2016).
The interest in propaganda helped define a somewhat narrow spectrum of wartime situations that came into research focus. These are mainly major interstate military conflicts of the previous century, when readership among children was already well established, and the stakes of state propaganda were high. In contrast, there are practically no studies that address children’s literature during local wars, and conflicts prior to the 20th century (for a rare example, see Grenby 2008).
Beyond propaganda and censorship, -little evidence supports generalizations about the ways in which wartime disasters may impact children's literary processes. For instance, there are practically no studies of changes in wartime children’s literature in economic, institutional, and demographic terms. A complete survey is still required in this case. A better understanding of various historical examples of wartime transformations in children’s literary institutions and content paves the way for new questions. How profound can wartime impact on children’s literature be, in terms of both quantity and quality? Which wars have been discussed in children’s literature and which are left in silence, and why? Are the effects of the wartime transformations transient, or do they persist after the end of the war? Does the fate of military children’s literature depend on the outcome of the war? We invite interested authors to join our effort to fill the apparent gaps in the study of wartime children’s literature, and to discuss these questions in the special issue.
For this particular issue, we suggest mostly leaving aside post-war representations, and to address neglected aspects of wartime changes, including (but not limited to):
- Literary content. The production of texts about the war and for the war: in what ways do the themes and plots of children’s literature change? What forms does militarist and pacifist propaganda assume? What is told, and what remains silent?
- Economy and publishing record. Нow does war affect the publication of children’s literature? Which publications are discarded (through military censorship or lack of printing resources)? Which are preserved, and which are intensified?
- Wartime readership. How does war affect children’s reading, both in terms of accessibility of material, content, and contexts of reading.
- Institutional structure. How does war transform the institutions involved in the production of children’s literature, for instance publishing, censorship, and criticism?
- The demographic dimension. How does war affect authors? Who joins and who leaves the ranks of wartime writers?
- Authors’ strategies. How do writers alter their behaviors? What books do they write? What books are reprinted? When do authors start writing about the war?
Proposals (approximately one page in length) should be sent by 15 January 2024 to strenaerevue@gmail.com. Final articles will be due on 10 June 2024.
Bibliographie
Agnew, Kate and Fox, Geoff, Children at War: From the First World War to the Gul, Softcover, London, Continuum, 2001.
Benner, Julia Federkrieg, Kinder- und Jugendliteratur gegen den Nationalsozialismus 1933-1945, Wallstein, 2015.
Budgen, David, British children’s literature and the First World War: representations since 1914, London, Bloomsbury, 2018.
Campagnaro, Marnie, La Grande Guerra raccontata ai ragazzi, Donzelli, 2015.
Darr, Yael, “Nation Building and War Narratives for Children: War and Militarism in Hebrew 1940’s and 1950’s Children’s Literature”, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, Vol. 48, No. 4, August 2012, 601-613.
Galway, Elizabeth A., The Figure of the Child in WWI American, British, and Canadian Children’s Literature: Farmer, Tailor, Soldier, Spy, New York, Routledge, 2022.
Grenby M. O., “Surely there is no British boy or girl who has not heard of the battle of Waterloo!” War and Children’s Literature in the Age of Napoleon. In: Elizabeth Goodenough and Andrea Immel, ed. Under Fire: Childhood in The Shadow Of War, Detroit, Wayne State University Press, 2008, pp.39-57.
Hamaide-Jager Eléonore, La Shoah en mots et en images. De Perec à la littérature de jeunesse, Rouen, PURH, 2023. DOI : 10.18574/nyu/9780814796078.001.0001
Marten, James (ed.), Children and Youth during the Civil War Era, New York, London, New York University Press, 2012. DOI : 10.18574/nyu/9780814796078.001.0001
Milkovitch-Rioux, Catherine et alii (ed.), Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse, XXe-XXIe siècles, actes du colloque des 18 et 19 octobre 2012, organisé par la Bibliothèque nationale de France, Centre national de la littérature pour la jeunesse, avec l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique, UBP-CELIS.
Paul, Lissa et alii (ed.), Children’s Literature and Culture of the First World War, New York, Routledge, 2016.
Olivier-Messonnier, Laurence, Guerre et littérature de jeunesse, 1913- 1919 : analyse des dérives patriotiques dans les périodiques pour enfants, L’Harmattan, 2012.
Paris, Michael, Over the Top: The Great War and Juvenile Literature in Britain, Westport, CT, Praeger, 2004.
Sinibaldi, Caterina, Between Censorship and Innovation: The Translation of American Comics during Italian Fascism, New Readings, 2016, Vol. 16, pp. 1-21.
Roig, Blanca-Ana et alii (ed.), The Representations of the Spanish Civil War in European children’s literature (1975-2008), Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2014.
Tan, Fengxia, Nelson, Claudia, « Can You Hear My Cry?’ Representing War and Trauma in Picturebooks for Peace from China, South Korea, and Japan », International Research in Children’s Literature, February 2022, vol. 15, No. 1, pp. 1-14.
Zunino, Bérénice, Die Mobilmachung der Kinder im Ersten Weltkrieg Kriegskultur und illustrierte Kriegskinderliteratur im Deutschen Kaiserreich (1911–1918), Berlin, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag, 2019.
Zur, Dafna, « Representations of the Korean War in North and South Korean Children’s Literature », In: Korea 2010: Politics, Economy, Society, 2010, p. 271–300.
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CFP: Wir – Ihr – Sie
Kollektive Akteure der deutschsprachigen Literatur für und über Jugendliche (18. Jh. bis zur Gegenwart)
Mit der "Emanzipation des Individuums" (E. E. Noth 1933/2001) in der Literatur seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch die Jugend als eigenständige Lebensphase und Thema der Literatur neu entdeckt und mit ihr die Geschichte des Bildungs- und Entwicklungsromans weitergeschrieben. In dieser Zeit ist auch ein Höhepunkt des historischen Adoleszenzromans zu verzeichnen.
Wie aber hängt das emanzipierte Individuum mit der Neuentdeckung der Jugend zusammen? Ist die Literaturgeschichte der Jugend eine Literaturgeschichte des Individuums und der individuellen Psyche? Welche Rolle spielen dann Figuren des Kollektiven in Texten, die sich dezidiert mit Jugendlichkeit auseinandersetzen? In welchen Konstellationen und Konfigurationen finden sich Kollektive wie Jugendgruppen und Banden in der Allgemeinliteratur und in der Kinder- und Jugendliteratur? Wie werden sie erzählt, wie sind ihre Funktionen in der Handlung und deren Entwicklung? Eignen sich bestimmte literarische Gattungen und Genres besonders für die Darstellung von Kollektiven? Sind literaturhistorische Konjunkturen auszumachen? Wie können hier zeitgenössische Diskurse oder spätere Theorien und Theoreme aus Bereichen wie der Soziologie, Psychologie, Narratologie zur Diskussion dieser literarischen Figuren und Figurationen des Kollektiven herangezogen werden?
Ausgehend von der Beobachtung, dass im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vermehrt kollektive Figuren und Akteure in der Literatur für Kinder und Jugendliche auftreten (Steinlein 1999), soll der Workshop die Geschichte, Funktionen und Potenziale des Kollektivs anhand exemplarischer Beispiele vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart untersuchen.
Folgende Themenkomplexe sind ein erstes Orientierungsangebot für Vorträge im Rahmen des Workshops:
Ich/Wir - Möglichkeiten der Erzählung
Als beliebtes Motiv der KJL bieten die Gruppe, die Bande, die Clique die Möglichkeit eines Typenpanoramas von Charakteren. Dies bedeutet jedoch selten den Verzicht auf eine Hauptfigur. Vielmehr wird das Kollektiv oft zum Hintergrund und Kontext einer individuellen Entwicklung und einer individuellen Ich-Erzählung. Spricht jedoch stets ein Ich oder eine nullfokalisierte Erzählstimme für die Gruppe? Welche Möglichkeiten gibt es für ein Wir in der Allgemeinliteratur und der KJL? Und was verändert sich, wenn das Wir ein jugendliches ist? Oder sind literarische Kollektive per se jugendlich?
Homogen/Heterogen – Typologien und Funktionen der Gruppe
Als heterogenes Kollektiv fungiert die Gruppe in den Texten oft entweder als Abbild oder aber als Korrektiv der bestehenden Gesellschaft – je nachdem, ob es dem Text um Ordnungsstabilisierung oder Gesellschaftskritik geht. So ist nicht nur das Problem der Darstellbarkeit einer Ganzheit im Modus eines überfordernden panoramatischen Blicks zugunsten der Exemplarität gelöst. Auch Kategorien wie ökonomische und soziale Klasse, Geschlecht, nationale und ethnische Zugehörigkeit werden darüber ausgehandelt. Kollektive eignen sich besonders gut, so wäre einer der vorläufigen Thesen, für die Darstellung und Aushandlung struktureller Probleme. Vor diesem Hintergrund wäre die Literatur des Kollektivs abseits einer an Introspektion und individueller Psyche interessierten Literatur zu suchen.
Beständig/Temporär – Dauer des Kollektivs
Jugendliche Banden und Cliquen sind soziale Gebilde, die zeitlich den Prozess des Heranwachsens und diverser Initiationen ins Leben der Erwachsenen begleiten. Doch wie sind Entwicklungsprozesse in Gruppen denk- und darstellbar? Während individuelle Figuren oft narrativ über längere Zeitperioden begleitet werden, lässt sich beobachten, dass Gruppengeschichten meist über geringe erzählte Zeit verfügen. Auf den ersten Blick scheint in den vorliegenden Texten die einzige Entwicklung, der Gruppen unterliegen, der Zerfall zu sein. Die Auflösung der Jugendbande und Clique ist oft gar die Bedingung für die gelungene Selbstfindung der individualisierten Figur und deren Übertritt in die bürgerliche Gesellschaft der Erwachsenen. Als Ersatzfamilien auf Zeit sind Kollektive oft Platzhalter für die fehlende Fürsorge durch Eltern und Staat.
Gruppenpolitik
Gerade vor dem Hintergrund von Krieg, politischen, ökonomischen und ökologischen Katastrophen setzt die Literatur Gruppenbildungen als Gegenpunkt zu zerrütteten Gesellschaften. Denn Kollektive bieten sichere Räume für Jugendliche, für die Entstehung widerständiger Subkulturen sowie Räume für Grenzüberschreitungen und Regelverstöße. Dass Jugendbanden und -gruppen sich aus soziologischer und literaturhistorischer Perspektive oft im Abseits einer Gesellschaft der Erwachsenen und des Mainstreams sehen, übersetzt sich jedoch nicht in Anarchie oder Chaos. Ganz im Gegenteil weisen Gruppen innere Hierarchien und Machtdynamiken, Regeln, Verhaltenscodices und Kleidungsetikette auf, die sie für das Außen erst erkennbar machen. Kollektive figurieren in der Literatur als subkulturelle, antiautoritäre Einheiten einerseits – sie können Widerstand leisten und Kritik üben, gar eine politische Opposition bilden. Andererseits können sie aber auch einen Verweis auf die große, anonyme Masse sein und zum Mitläufertum agitieren.
Ausgehend von diesen Beobachtungen und vorläufigen Fragestellungen soll der Workshop eine erste Möglichkeit für Diskussion und Erkundungen des Kollektiven in der Literatur über und für Kinder und Jugendliche von 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart bieten.
Erwartet werden 30-minütige Vorträge, auf die eine 15-minütige Diskussion folgt.
Bitte senden Sie bis zum 3.12.2023 kurze Abstracts (300 Wörter) mit Themenvorschlägen sowie eine kurze Biobibliographie an dariya.manova@univie.ac.at.
Der Workshop findet vom 20.3. bis 22.3.2024 in Wien statt.
(Quelle: Aussendung & H-Germanistik)
CfP: „Beyond Pinocchio, Cuore, and Telephone Tales: Exploring Contemporary Italian Children’s Literature”
Bookbird: A Journal of International Children’s Literature is seeking contributions for a special issue on Italian
Children’s literature. Italian Children’s literature is generally associated with three texts: Carlo Collodi’s The Adventures of Pinocchio (1883), Edmondo De Amicis’ Cuore [The Heart of a Boy](1886), and Gianni Rodari’s Favole al telefono [Telephone Tales](1962). These texts are often considered embodiments of the three classic muses of Italian Children’s Literature: Pedagogy, Aesthetics, and Humanism.
In the past five decades, however, Italian Children’s Literature has undergone significant changes in contents, genres, narrative structure, literary language, visual and poetical composition. Authors such as Bruno Tognolini, Beatrice Masini, Giusi Quarenghi, Mino Milani, Angela Nanetti, Bianca Pitzorno and Roberto Piumini have introduced significant innovation to Italian Children’s literature. Their literary experimentations and new storytelling techniques have inspired a new generation of Italian children’s authors and poets (Chiara Carminati, Davide Calì, Sabrina Giarratana, Silvia Vecchini). Genres start to blend, blurring the boundaries between fiction and nonfiction and presenting multiple perspectives on stories or retelling of the same story.
Several illustrators have expanded the possibilities of visual storytelling, transforming picturebooks into valuable sociocultural and historical documents with high aesthetic value. For instance, Roberto Innocenti’s works raise important questions about the representations of the Holocaust in children's literature. Alessandro Sanna’s wordless graphic novel, The River, connects geography to the flow of time, providing an ethnographic account of the twentieth century in some of North Italy’s poorest areas. Meanwhile, illustrators like Beatrice Alemagna and Chiara Carrer have reimagined children’s characters, creating innovative and visionary characters even for very young children. Attilio has 13 constructed visual microcosms specifically designed for toddlers. Other authors, like Arianna Papini and Pia Valentinis, have explored the liminal spaces between fiction and nonfiction.
The focus of this special issue of Bookbird is on the lesser-known contemporary production of Italian Children’s literature.
The editors invite submissions that address the following themes:
- History and modern classics of Italian Children’s literature
- Comparative analysis on Italian contemporary children’s texts
- Adaptation and transmediation of Italian children’s classics and contemporary children’s books
- Visual, graphical and typographical trends in contemporary Italian picturebooks
- Migrations, cultural diversity and post-colonial Italian children’s stories
- Playfulness and materiality in Italian books for children aged 0-3
- Poetry and melody in Italian children’s tradition
- Challenging Italian nonfiction for children
Full papers should be submitted to the guest editor Marnie Campagnaro (marnie.campagnaro@unipd.it) and the editor, Chrysogonus Siddha Malilang (chrysogonus.siddha.malilang@mau.se), by 30 September 2023. They also welcome submissions for “Letters” and “Children and Their Books” with the same topics. Please see Bookbird’s website at www.ibby.org/bookbird for full submission details.
(Quelle: Aussendung)
CFP: Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung 2024
Thema: Komik
Was ist komisch daran, dass Wednesday Addams in Tim Burtons TV-Serie Wednesday (USA 2022) zwei Plastiktüten voller Piranhas in den Pool entlässt, in dem die aufstrebenden Sportler der Nancy-Reagan-High School trainieren? Und warum lachen wir, wenn Gomez Addams seine Tochter wahlweise als «my little viper» oder «my little death-trap» bezeichnet? Die Antwort liegt auf der Hand in dieser Serie, die so lustvoll mit dem Tod, der Farbe Schwarz und ihren Implikationen spielt. Doch nicht nur der schwarze Humor braucht ein bestimmtes Setting, das zu Transgressionen und Regelbrüchen einlädt; ähnliche Voraussetzungen gelten auch für sanftere und damit vorgeblich ‘kindgemäßere’ Spielarten des Komischen, von Autor*innen wie Astrid Lindgren, Dr. Seuss, Otfried Preußler, James Krüss, Goscinny und Sempé oder Michael Ende. In diesen Texten galt Kindheit, in Abgrenzung von einer grundsätzlich ernsten Erwachsenenexistenz, als heitere Daseinsform. Aktuell werden Kindheit und Jugend auf unterschiedliche Weise imaginiert. Das Spektrum komischer Verfahren, die zum Einsatz kommen, reicht von Auslotungen des komischen Potentials im Alltag – Situations- und Charakterkomik – über Sprachspiele und Nonsens bis zum schwarzen Humor, dem Spiel mit dem Absurden und Grotesken. Umso erstaunlicher erscheint der Befund, dass die aktuelle Kinder- und Jugendmedienforschung sich nur sehr punktuell mit Verfahren und Affektpoetiken des Komischen befasst: Es fehlt eine Auseinandersetzung mit neueren Komiktheorien und ihrem Potential für die Analyse kinder- und jugendliterarischer Texte.
Der achte Jahrgang des open-access, peer-reviewed Jahrbuchs der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung möchte einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke leisten und widmet sich in seiner nächsten Ausgabe gegenwärtigen wie historischen Dimensionen von Komik in Kinder- und Jugendliteratur und -medien, insbesondere poetologischen und ästhetischen Aspekten.
Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen des Themas sowohl aus theoretischer als auch aus gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen erzählerischen und medialen Realisierungen (Romane, Kurzprosa, Lyrik, Theaterstücke, Bilderbücher, Sachbücher, Comics, Graphic Novels, Hörmedien, Filme, TV-Serien, Computerspiele) aufgreifen.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
- Komiktheorien und Kinder- und Jugendliteratur/-medien
- Verfahren des Komischen in Literatur und Medien für Kinder- und Jugendliche
- Komik und Stereotype im kulturwissenschaftlichen Kontext (race, class, gender)
- Komik in inter- und transmedialer Perspektive
- Komik und Serialität
- Affektpoetiken des Komischen, Komik und Affect Studies
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem offene Beiträge zu kinder- und jugendliterarischen bzw. -medialen Fragestellungen aus historischer, wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch dazu wird um entsprechende Vorschläge gebeten.
Formalia:
Die GKJF hofft auf große Resonanz und bittet bei Interesse um die Zusendung von entsprechenden Angeboten für themenbezogene bzw. offene Beiträge in Form eines Exposés (von nicht mehr als 2.000 Zeichen mit Leerzeichen) bis zum 15.09.2023. Die Exposés sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung enthalten, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt. Benachrichtigungen über die Annahme des Vorschlags und die Einladung zur Einreichung eines Beitrags werden zusammen mit dem Style Sheet bis zum 31.10.2023 verschickt.
Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (inkl. deutschem wie englischem Abstract, Fußnoten, Literaturverzeichnis und Kurzvita) nicht überschreiten und den Herausgeberinnen spätestens bis zum 01.03.2024 als Word-Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an: jahrbuch@gkjf.de
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung | GKJF 2024 wird im Dezember 2024 auf der Seite https://ojs.ub.uni-frankfurt.de/gkjf veröffentlicht.
(Quelle: H-Germanistik)
CFP: Unzuverlässiges Erzählen in unterschiedlichen Medien – Perspektiven für den Literaturunterricht
Unzuverlässiges Erzählen in der Kinder- und Jugendliteratur ist bisher relativ wenig beforscht (vgl. Wallraff 2020: 145). Eine der wenigen Ausnahmen bilden Klimeks Ausführungen (vgl. Klimek 2017), die sich gerade der unzuverlässig erzählten Welten in kinder- und jugendliterarischen Texten nähert. Für den allgemeinliterarischen Diskurs gilt diese Beobachtung der dürftigen Forschungslage nicht in demselben Maße (vgl. den Überblick in Martínez/Scheffel 2016; Nünning 2008; Kindt/Köppe 2014: 239-245). Zentrale Unterscheidungen bestehen unter anderem zwischen mimetisch unentscheidbarem Erzählen (Martìnez/Scheffel 2016), täuschendem Erzählen (Kindt/Köppe 2014: 239) und offen unzuverlässigem Erzählen (vgl. ebd.: 242). Darüber hinaus sind grundsätzlich auch paratextuelle oder intertextuelle Signale zu berücksichtigen (vgl. Wallraff 2020: 21 und 313).
Fraglich bleibt, welche Rolle unzuverlässiges Erzählen im Literaturunterricht hat/haben kann/haben sollte. So bleibt die Auseinandersetzung mit Unzuverlässigkeit in vielen Handreichungen für den Unterricht aus. Kürschner beispielsweise befürchtet, das die durch Unzuverlässigkeit vorausgesetzten Lesestrategien für kindliche Rezipient:innen zu anspruchsvoll seien (vgl. Kürschner 2014: 29). Leubner und Saupe betonen, Phänomene wie unzuverlässiges Erzählen seien vornehmlich leistungsstärkeren und/oder fortgeschrittenen Lerngruppen vorbehalten (vgl. Leubner/Saupe 2012: 154). Die Frage, die sich stellt, ist allerdings, ob es wirklich zu einer expliziten Auseinandersetzung mit dem Phänomen im Rahmen des Unterrichts kommen muss oder ob der Umgang mit Unzuverlässigkeit auch ohne eine explizite Fokussierung bereits den Umgang mit Texten und Medien aufschließen kann (vgl. dazu auch Bernhardt/Henke 2023).
Eines der wenigen Modelle für den didaktischen Umgang mit erzählerischer Unzuverlässigkeit legt Wittmann (2016) mit seiner Darstellung von Kehlmanns Ruhm vor. Henke (2020) modelliert das Unzuverlässige Erzählen bereits für frühere Jahrgangsstufen und plädiert dafür, das Konzept Unzuverlässigen Erzählens stärker in der Lehrer:innenbildung zu berücksichtigen. Sie zeigt, dass die Auseinandersetzung mit erzählerischer Unzuverlässigkeit auch einen Beitrag zur Demokratiebildung leisten kann (vgl. Henke 2021). Hofmann (2023) demonstriert am Beispiel von Kleists Werken, dass unzuverlässiges Erzählen zu einer Hinterfragung von Machtstrukturen in Texten einladen und dadurch einen machtreflexiven Blick auf Strukturen allgemein ermöglichen könne. Bernhardt (2020, 2022) sowie Beck/Bernhardt (2023) plädieren am Beispiel von Texten ab der Primarstufe für eine stärkere didaktische Berücksichtigung des Phänomens, wobei es nicht darum gehen soll, das narratologische Phänomen bereits zu lehren, sondern vielmehr darum, die Materialität des Gegenstandes zur Förderung literarischer Kompetenzen und zur Anbahnung einer kritischen Hinterfragung zu nutzen. Jakobis (2023) Plädoyer für eine transmediale Erweiterung des Blicks auf Unzuverlässigkeit erscheint dabei als ausgesprochen zentral. Sie stellt heraus, dass auch im intermodalen Zusammenspiel beispielsweise bei Bilderbüchern unzuverlässiges Erzählen vorliegen könne und zeigt, dass eine transmediale Betrachtung des Phänomens wichtig wäre.
Im geplanten Sammelband soll es daher nicht nur um gedruckte Texte, sondern auch um Hörspiele, Filme, Theateraufführungen, Ausstellungen und weitere fiktionale geschichtenerzählende Gegenstände gehen.
Zu klären sind folgende Fragestellungen:
- Wie lässt sich Unzuverlässiges Erzählen literaturdidaktisch nutzbar machen?
- Muss Unzuverlässiges Erzählen als Konzept schon Einzug in den Literaturunterricht der Primarstufe halten oder gibt es Möglichkeiten einer Sensibilisierung für eine kritische Hinterfragung ohne Explikation des narratologischen Konzepts?
- Wie verhält es sich mit transmedialen Besonderheiten?
- Inwiefern lassen sich durch die Auseinandersetzung mit Unzuverlässigem Erzählen Kognitionsroutinen durchbrechen und so kumulativ und nachhaltig literarische Kompetenzen fördern?
Erbeten werden Beitragsvorschläge zu folgenden Themenspektren:
1. Konzepte zum Umgang mit Unzuverlässigem Erzählen in unterschiedlichen Klassenstufen
- in Romanen
- in Dramen
- in Bilderbüchern
- in Hörspielen/Hörbüchern
- in Filmen
- in seriellen Formaten
- in Ausstellungen
- in Medienverbünden
- gern weitere Vorschläge (Comics, Spiele, …)
2. Beispielausarbeitungen (bitte konkrete Gegenstände (Hörspiele, Theateraufführungen, Romane) angeben, gern auch Praxisbeispiele
3. Diskussion von Voraussetzungen und Schwierigkeiten bei der curricularen Umsetzung der Fokussierung von Unzuverlässigkeit
Um den Lesefluss nicht zu stören, sollten die Beiträge auf eine ausführliche theoretische Herleitung verzichten und den Schwerpunkt auf die didaktischen Perspektiven legen. Es sollte also nur eine Festlegung des eigenen Theoriebezugs erfolgen und keine Genese des Forschungsstandes abgebildet werden. Eine theoretische Grundierung wird in der Einleitung und in den Grundlagenartikeln erfolgen, sodass die Konzepte in den Einzelausarbeitungen vorausgesetzt werden können. Nach einer Sichtung aller Beitragsvorschläge wird es auch die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch geben, um Überschneidungen zu vermeiden. Das Projekt ist also genuin als kommunikativer Arbeitsprozess erwünscht.
Wenn Sie Interesse haben, senden Sie bitte bis zum 5.10.2023 einen Beitragsvorschlag (max. 1 Seite) mit bio-bibliographischen Angaben an den Herausgeber:
Prof. Dr. Sebastian Bernhardt
Germanistisches Institut der Universität Münster
Abteilung: Literatur- und Mediendidaktik,
Professur für Literatur- und Mediendidaktik (Prof. Bernhardt)
Mail: sbernhar@uni-muenster.de
Zeitplan:
- Abgabe der Beiträge (Umfang: maximal 40.000 Zeichen): 8.4.2024
- Erscheinen des Bandes: spätestens 1.8.2024
Die Beiträge werden allesamt bis spätestens 10.4.24 lektoriert und kommentiert. Es gibt dann eine Überarbeitungsphase und eine zweite Rücklaufschleife. Damit der Band zügig erscheint, wird darum gebeten, diese Schleifen gleich einzuplanen, damit im Sommer gut mit der Einreichung des Manuskripts fortgefahren werden kann.
Der Band wird als print und eBook in meiner Reihe „Literatur – Medien – Didaktik“ im Verlag Frank & Timme erscheinen und über die Springer Bibliotheken abrufbar sein.
Prof. Dr. Sebastian Bernhardt freut sich sehr auf Ihre Beitragsvorschläge.
Literaturhinweise (sehr selektiv):
Beck, Natalie/Bernhardt, Sebastian (2023): „Wahrheit in Reifenbergs metafiktionalen Kinderromanen. Die Unzuverlässigkeit des Erzählens und ihre Potenziale für das literarische Lernen ab der Primarstufe.“ In: Bernhardt, Sebastian (Hg.): Frank Maria Reifenberg in literaturdidaktischer Perspektive. Berlin: Frank & Timme. S. 69–89.
Bernhardt, Sebastian (2020): „Fremdverstehen in und durch Juli Zehs Kinderbuch‚Das Landder Menschen‘ (2008)“. In: Standke, Jan (Hg.): Das Werk Juli Zehs in literaturdidaktischer Perspektive. Trier: WVT. S. 63–76.
Bernhardt, Sebastian (2022): „Kehlmanns historische Romane im Deutschunterricht.“ In: ders. und Standke, Jan (Hg.): Historische Romane der Gegenwart im Deutschunterricht. Bielefeld: transcript. S. 217–238.
Hansen, Per Krogh (2007): „Reconsidering the unreliable narrator.“ In: Semiotica 165, 1/4, S. 227–246.
Heiser, Ines (2023): „Wenn man auf den wichtigsten Teil erst sehr spät kommt – Unzuverlässiges Erzählen in Reifenbergs Identity X – Wer ist Boston Coleman? (2022)“. In: Bernhardt, Sebastian (Hg.): Frank Maria Reifenberg in literaturdidaktischer Perspektive. Berlin: Frank & Timme. S. 111-130.
Henke, Ina (2021): „Unzuverlässig erzählte Welten verstehen. Kognitive Operationen von Schüler*innen beim Umgang mit narrativer Unzuverlässigkeit.“ In: MiDU. Medien im Deutschunterricht 3, H.2, S. 1–19.
Hermann, Leonhard (2021): „Wann ist Erzählen eigentlich zuverlässig? Mimetisch unzuverlässiges Erzählen als graduelles Phänomen und seine Funktion in Romanen der Gegenwart.“ In: ZfG NF XXXI, S. 19–35.
Hofmann, Michael (2023): „Unzuverlässiges Erzählen als Herausforderung der Literaturdidaktik. Konzeptionelle Überlegungen mit Bezug auf Heinrich von Kleists Verlobung in St. Domingo.“ In: Bernhardt, Sebastian/Henke, Ina (Hg.): Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht. Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, Stuttgart: J.B. Metzler. S. 87-100.
Jakobi. Stefanie (2023): „Wider die Rezeptionsästhetik? Transmediale und transgenerische Unzuverlässigkeit in den Kinder- und Jugendmedien aus wirkungsästhetischer Perspektive“. In: Bernhardt, Sebastian/Henke, Ina (Hg.): Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht. Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, Stuttgart: J.B. Metzler. S. 101-114.
Kindt, Tom/Köppe, Tilmann (2014): Erzähltheorie. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam.
Klimek, Sonja (2017): „Unzuverlässiges Erzählen in Kinder- und Jugendliteratur und -medien? Eine vergleichende Studie.“ In: kids&media. Zeitschrift für Kinder- und Jugendmedienforschung 2, S. 24–44.
Kürschner, Manja (2014): „Vom Verstehenwollen und dem Wertschätzen des Nichtverstehens–Unzuverlässiges Erzählen als Naturalisierungsstrategie beim Lesen postmodernistischer Romane.“ In: Niebuhr, Oliver (Hg.): Formen des Nicht-Verstehens. S. 25-44.Frankfurt am Main: Peter Lang.
Martínez, Matías/Scheffel, Michael ([¹1999] 2016): Einführung in die Erzähltheorie. München: C.H. Beck.
Nünning, Ansgar (1998): „Unreliable Narration zur Einführung: Grundzüge einer kognitiv-narratologischen Theorie und Analyse unglaubwürdigen Erzählens.“ In: Ders. (Hg.): Unreliable narration. Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. S. 3–40. Trier: WVT.
Rietz, Florian (2021) „Unzuverlässiges Erzählen in Andreas Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten. Überlegungen zur Förderung von Perspektivübernahmekompetenz im Literaturunterricht.“ In: Standke, Jan/Wrobel, Dieter (Hg.): Andreas Steinhöfel. Texte–Analysen–didaktische Potenziale. Trier: WVT. S. 97-110
Schulte Eickholt, Swen (2023): „Wolf Schmids idealgenetisches Modell der narrativen Ebenen im Kontext eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts“. In: Bernhardt, Sebastian/Henke, Ina (Hg.): Erzähltheorie(n) und Literaturunterricht. Verhandlungen eines schwierigen Verhältnisses, Stuttgart: J.B. Metzler. S 135-150.
Wittmann, Jan (2016): „Unzuverlässiges Erzählen im Deutschunterricht: Kehlmanns Roman ‚Ruhm‘“. In: Pieper, Irene/Stark, Tobias (Hg.): Neue Formen des Poetischen: Didaktische Potenziale von Gegenwartsliteratur, Frankfurt am Main: Peter Lang. S.17-34.
Wallraff, Nana (2021): Unzuverlässiges Erzählen als narratives Verfahren in der Kinder- und Jugendliteratur seit der Jahrtausendwende. Köln: epub. URL: kups.ub.uni-koeln.de/50389/1/Wallraff_Unzuverlaessiges_Erzaehlen.pdf (letzter Zugriff: 01.09.2023).
Wallraff, Nana (2020): „Unzuverlässiges Erzählen.“ In: Kurwinkel, Tobias/Schmerheim, Philipp (Hg.): Handbuch Kinder- und Jugendliteratur. Berlin: Springer, S. 145–150.
Wicke, Andreas (2022): „Intertextualität und Intertextualitätstheorien im Deutschunterricht.“ In: Bernhardt, Sebastian & Hardtke, Thomas (Hg.): Interpretation. Literaturdidaktische Perspektiven. Berlin: Frank & Timme, S. 95–114.
Wittmann, Jan (2016): „Unzuverlässiges Erzählen im Deutschunterricht: Kehlmanns Roman ‚Ruhm‘.“ In: Pieper, Irena & Stark, Tobias (Hg.): Neue Formen des Poetischen. Didaktische Potenziale von Gegenwartsliteratur. Frankfurt a.M.: Peter Lang, S. 17–34.
(Quelle: H-Germanistik)
CfP und Tagung: Bunte Hunde
Der beste Freund des Menschen in der Kinder- und Jugendliteratur aus literarischer und bilderbuchkünstlerischer Perspektive
Zeitraum: 23. bis 25. Februar 2024
Ort: Phantastische Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar
Die meist liebevolle Verbindung zwischen Tier und Mensch spielt innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur eine besondere Rolle und hat nicht zuletzt auch etliche Klassiker nachhaltig geprägt. Dabei spiegelt das Mensch-Tier-Verhältnis oder auch der Exkurs in eine anthropomorphisierte Tierwelt nicht selten gesellschaftliche Zusammenhänge. Hunde nehmen hier eine besondere Rolle ein.
In der westlichen Kultur wird der Hund von jeher als bester Freund des Menschen betrachtet. Er ist Haustier, Wächter und Statussymbol, wird zur Arbeit herangezogen, ist unterwürfiger Diener und treuer Gefährte. In der Literatur werden Hunde sowohl in ihrer Beziehung zum Menschen dargestellt als auch in reinen Tiergeschichten; sie spielen eine Rolle in realistischen Texten und Filmen, finden ihren Platz aber auch in der phantastischen Literatur. Bilderbücher und Comics kennen zahlreiche Hunde, die uns durch ihre Weisheit und philosophischen Ideen bisweilen schmunzeln lassen, und immer wieder rührt uns das Schicksal eines besonderen Hundehelden zu Tränen. Um die Faszination „Hund“ wissen also zahllose Bücher, Filme und Geschichten. Trotzdem ist der Hund als fester Bestandteil kinder- und jugendliterarischer Werke bislang kaum in den Fokus der Forschung gerückt. Diese Lücke soll mit der hybriden Veranstaltung aus Literaturwissenschaft, Didaktik sowie Lese- und Literaturpädagogik im Februar des kommenden Jahres geschlossen werden. Die Tagung möchte die Figur des Hundes in ihren unterschiedlichen Ausformungen und Funktionen im phantastischen und realistischen Kinder- und Jugendbuch analysieren, ihren Einfluss im Film zeigen und dabei auch nicht vergessen, eine Brücke zu den realistischen Hunden in unserem Leben zu schlagen, wo sie sich gerade ihren Platz in Therapiestunden und in der Leseförderung erobern.
Dabei soll u.a. auf folgende Fragestellungen eingegangen werden:
- Welche medialen Repräsentationen gesellschaftlicher Konstruktionen von Hunden finden sich in den unterschiedlichen Medien (z.B. Büchern, Bilderbüchern, Comics, Filmen, Hörspielen)?
- Welche (inter)kulturelle Diversität gesellschaftlicher Konstruktionen des Mensch-Hund-Verhältnisses lässt sich beobachten?
Die Veranstaltung ist als interdisziplinärer Austausch von ‚Hundemenschen‘ und Buchschaffenden, Literaturwissenschaftler:innen, pädagogischen Fachkräften sowie Expert:innen des Kinder- und Jugendbuchmarkts geplant und eignet sich damit für Bibliothekar:innen, pädagogische Fachkräfte aus den Bereichen Kita und Schule, Literatur- und Kulturvermittler:innen, Studierende oder einfach Menschen, die es lieben, sich mit Literatur (und Hunden) zu beschäftigen.
Die Veranstalterinnen laden Sie sehr herzlich ein und freuen sich auf viele interessante Themen und Begegnungen.
Bitte reichen Sie bis zum 30. September 2023 Abstracts mit Beitragsvorschlägen (max. 350 Wörter) in dem weiten Feld der Mensch-Hund-Beziehung in der Kinder- und Jugendliteratur in Form von
- Vorträgen im Umfang von 30 Minuten (+ Diskussion)
- Workshops im Umfang von 90 Minuten (+ Diskussion)
per E-Mail an Maren Bonacker (Maren.Bonacker@web.de), Christine Paxmann (paxmann@eselsohr-leseabenteuer.de) und Dr. Jana Mikota (mikota@germanistik.uni-siegen.de) ein.
Die Mitteilung über die Annahme der Abstracts soll bis zum 30. Oktober 2023 erfolgen.
Die Tagung wird als Kooperationsveranstaltung von den folgenden Institutionen getragen: Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, Phantastische Bibliothek Wetzlar, Universität Siegen, ESELSOHR und Bundesverband Leseförderung (BVL).
Die Tagung wird vom BVL als lese- und literaturpädagogische Weiterbildung anerkannt. Die anzurechnenden UEs werden zusammen mit dem fertigen Programm bekannt gegeben.
Veranstalterinnen: Maren Bonacker, Christine Paxmann und Dr. Jana Mikota
(Quelle: Aussendung)
CfP Sammelband
„Arme Kinder“? Soziale Ungleichheit(en) in Kinder- und Jugendmedien
Jedes vierte Kind wächst in der BRD in Armut auf. Während jedoch gender, race und disability den öffentlichen Diskurs prägen, bleibt die Differenzkategorie Klassismus, wie soziologische Studien hervorheben, unterrepräsentiert. Mit der Einkommensarmut der Familie gehen zahlreiche andere Benachteiligungen einher, die die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben sowie die Bildungschancen betreffen. Der Begriff Klassismus (engl. class) bezieht sich auf eine klassenbezogene Diskriminierung, d.h. es erfolgt eine Ausgrenzung aufgrund der sozialen Herkunft. Die Menschen werden systematisch abgeschnitten von Bildung und kultureller Teilhabe. Armut in den unterschiedlichen Facetten – von der materiellen bis hin zur Bildungsarmut – führt zur Diskriminierung; die Kinder erleben teilweise Scham, verschleiern ihre Lebensverhältnisse oder sind von der kulturellen Teilhabe ausgeschlossen. In der Literatur für Erwachsene wurde in letzter Zeit der Zusammenhang zwischen ökonomischer Armut und klassistischer Diskriminierung immer wieder zum Thema gemacht, nicht zuletzt durch den Nobelpreis an Annie Ernaux, die sich explizit mit dem Problem der "Scham" der Deklassierten beschäftigt hat, aber auch durch die Veröffentlichungen von Christian Baron, Anke Stelling oder Bjov Berg im deutschen Kontext. Eine grundlegende Auseinandersetzung im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur steht dagegen noch aus, sowohl literaturwissenschaftlich wie auch im literaturdidaktisch. Das ist den Herausgeberinnen des anvisierten Sammelbandes beim Zusammenstellen eines Materialheftes zum Thema "Armut in den Kinder- und Jugendmedien" aufgefallen, das im Zusammenhang mit der Vortragsreihe der AG Diversity der "Arbeitsgemeinschaft Jugend und Medien" entstand.
Folgende Fragen sollen in dem Sammelband untersucht werden:
- einen Überblick über das Thema in (kinder- und jugend-)literaturwissenschaftlicher Sicht zu bieten;
- über literaturdidaktische Möglichkeiten im Umgang mit dem Thema nachzudenken, aber auch Fragen der Literaturförderung für alle Klassen zu bedenken;
- ausgewählte Bücher nach der Darstellung von Armut und/oder Klasse zu untersuchen und zu fragen, wie man diese in schulischen und außerschulischen Kontexten einsetzen kann;
- literarhistorische Kontexte
Angebote für einen Beitrag werden mit einer knappen Skizze von ca. 300 Wörtern sowie einer kurzen biografischen Skizze bis zum 1. November 2023 erbeten, danach erfolgt eine Rückmeldung bis Mitte November zu möglichen Beiträgen. Die Vorschläge können an mikota@germanistik.uni-siegen.de und annette.kliewer@laposte.net geschickt werden. Der endgültige Beitrag von 30.-40.000 Zeichen soll bis zum 1. Mai 2024 eingereicht werden.
Herausgabe und Redaktion: Annette Kliewer & Jana Mikota
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Zwischen Leseförderung und literarischem Lernen
Auf der Suche nach einer Didaktik der (erzählenden) Erstleseliteratur
Termin: 27. und 28. September 2024
Tagungsort: Bürgerhaus Wilhelmsburg, Hamburg
Der Deutschunterricht in der Primarstufe steht vor komplexen Aufgaben: Neben der Entwicklung von Lesefähigkeiten sowie Lesefertigkeiten gehören auch Aspekte literarischen Lernens und die Förderung der ästhetischen Genussfähigkeit zu den zentralen Feldern. Bereits 2013 verweist Karin Richter auf diesen Aspekt und fragt zurecht, ob „der Erwerb von Lesefähigkeiten und -fertigkeiten auf der einen und vonLesemotivation und ästhetischer Genussfähigkeit auf der anderen Seite (zunächst) auf getrennten Wegen erfolgen muss“ (Richter 2013, S. 86) und Richter plädiert für unterschiedliche Lesestoffe: Leicht erschließbare Texte, um Lesefähigkeiten zu fördern; Texte für Lesemotivation und Texte, die literarische Genussfähigkeit unterstützen und vorgelesen werden können. Wie alarmierend gering die Lesefertigkeiten und Lesefähigkeiten von Kindern im Grundschulalter sind, konnten jüngst die Ergebnisse der IGLU-Studie 2021 verdeutlichen. Geringe Lesemotivation und ästhetische Genussfähigkeit sind hingegen empirisch schwerer zu erfassen, zumal sie abhängig von den individuellen Lesepräferenzen der Kinder sind.
Als Brücke zwischen Lesefertigkeiten, Lesemotivation und ästhetischer Genussfähigkeit wird oftmals das Potenzial von Erstleseliteratur herausgestellt – didaktische Ansätze, wie Erstleseliteratur in den (Deutsch-)Unterricht eingebunden und wie sie im schulischen Rahmen genutzt werden kann, gibt es hingegen nur sehr wenige. Daher soll auf der Tagung die Suche nach einer Didaktik der Erstleseliteratur beginnen und danach gefragt werden, wie der Spagat zwischen Leseförderung und literarischem Lernen mit Hilfe von Erstleseliteratur gelingen kann. Die Erstleseliteratur soll Kinder während des Prozesses des Lesenlernens begleiten und sie zum selbstständigen Lesen motivieren. Das heißt, einerseits fördert sie den Erwerb der Lesefähigkeiten, andererseits eröffnet sie auch als Erstleseliteratur Möglichkeiten der ästhetischen Genussfähigkeit und regt das literarische Lernen an (vgl. Mikota / Schmidt [Hrsg.] 2023). Erstlesebücher wie Werwolf wider Willen von Rüdiger Bertram und Ka Schmitz oder die Torkel-Bände von Charlotte Habersack und Susanne Göhlich können vielleicht, anders als Richter vermutet, sowohl zum Lesen motivieren als auch ästhetischen Genuss fördern. Trotzdem fristet die Erstleseliteratur innerhalb der literaturdidaktischen Forschung ein Schattendasein, wird allzu oft als Gebrauchs- und Zweckliteratur wahrgenommen und muss sich häufig der (nur scheinbar verallgemeinerbaren) Kritik einer literästhetisch minderwertvollen Gestaltung und einer oberflächlichen Ausrichtung an beliebten Themen aussetzen.
Für die Tagung kann die Bearbeitung folgender Fragen interessant sein – natürlich können weitere Themen hinzukommen:
- Welche Erstleseliteratur ist für die Arbeit im Deutschunterricht der Grundschule (aus welchen Gründen) besonders geeignet?
- Welche methodischen Zugänge eignen sich für die Arbeit mit Erstleseliteratur im Deutschunterricht?
- Welche Rolle können transmediale Zugänge (E-Books, Medienverbünde, Hörbuch, Film, Intermedialität) bei der Arbeit mit Erstleseliteratur spielen?
- Welche Vorstellungen und Wünsche haben Schüler:innen, Lehrer:innen und andere Akteur:innen im Bildungsbereich von der Arbeit mit Erstleseliteratur in der Schule?
- Wie wird Erstleseliteratur im Deutschunterricht eingebunden?
- Welche Rolle spielen Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen (z. B. Bibliotheken, KiTas, Leseförderprogramme, Lesementor:innen) bei der Arbeit mit Erstleseliteratur in der Schule?
- Welche bisherigen Erkenntnisse gibt es zur Arbeit mit Erstleseliteratur in der Schule und inwiefern können sie Einfluss auf aktuellere Reflexionen mit Blick auf den Einsatz im Unterricht haben?
Forscher:innen aus verschiedenen Disziplinen sind dazu eingeladen, sich mit diesen Fragen zu befassen. Die Tagung findet vom 27. Bis zum 28. September 2024 in Hamburg statt. Über Beitragsvorschläge für Vorträge (30 Minuten + Diskussion) in Form eines Abstracts (1000 Zeichen + Kurzvita) freuen sich die Veranstalter:innen. Senden Sie Ihre Abstracts bis zum 15. Oktober 2023 bitte an: Dr. Christoph Jantzen (christoph.jantzen@uni-hamburg.de), Dr. Jana Mikota (mikota@germanistik.uni-siegen.de) und Dr. Nadine J. Schmidt (schmidt@germanistik.uni-siegen.de ). Gerne kann vorab schon eine Interessensbekundung geschickt werden.
Die Veranstalter:innen bemühen sich um finanzielle Mittel, um den Vortragenden Übernachtungs- und Fahrtkosten erstatten zu können.
Literatur
Richter, Karin: Literarische Bildung und Lesemotivation in der Primarstufe. In: Rösch, Heidi (Hrsg.): Literarische Bildung im kompetenzorientierten Deutschunterricht. Fillibach bei Klett. Stuttgart 2013, S. 73-92.
McElvany, Nele / Lorenz, Ramona, Frey, Andreas / Goldhammer, Frank / Schilcher, Anita / Stubbe, Tobias C. (Hrsg.): IGLU 2021. Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre. Münster, New York: Waxmann 2023.
Mikota, Jana / Schmidt, Nadine J. (Hrsg.): Literarisches Lernen mit Erstleseliteratur im Unterricht. München: kopaed i. V. (erscheint 2023).
Veranstaltende: Universität Hamburg, Universität Siegen, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der GEW (AJuM), Landesstelle Hamburg, Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg
Tagungsleitung: Dr. Christoph Jantzen (Universität Hamburg), Dr. Jana Mikota (Universität Siegen), Dr. Nadine Schmidt (Universität Siegen), Maren Töbermann (Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg)
(Quelle: Aussendung)
CfP and Conference: The Child and the Book Conference Rouen 2024
“Making, Building, Mending: Creativity and Craftsmanship in Children’s Literature and Culture”
Date: 2-4 May 2024
Venue: University of Rouen Normandy, Campus Pasteur
In the past, bookish children have often been contrasted – sometimes fairly crudely – with their more practically-oriented counterparts, as if an interest in language, literature, and the world of fiction was necessarily incompatible with the ability and inclination to use one’s hands in order to “make” things.
Yet children’s ability to find and collect various materials and use them for all kinds of creative projects has been observed in past centuries and used for diverse educational purposes. Children’s literature itself abounds with representations/celebrations of various types of crafts, showing child characters inventing and making things, or recycling old or discarded objects. Building huts or other forms of shelter, for instance, is a fairly common theme. But young protagonists may also engage in fabricating toys, in quilting or sewing, in drawing or writing. In some cases, adult figures can also be shown to invent and make wonderful things, such as a child could imagine them, going through the process of identifying suitable materials, collecting and recycling them, and designing uses for the newly fabricated objects.
Creativity and craftsmanship are notions that may also be applied to the publishing/making of the book itself, both in a concrete, materialistic way and in a more abstract conceptual sense. The child reader may be invited to manipulate the book in order to make sense of it. (S)he may be invited to interact with its contents, thus developing different scenarios, or recreating new works on the basis of existing ones.
This is particularly in evidence in video games or digital narrations, but even in older and more traditional formats, references to the various fabrication processes mentioned earlier (cooking, building, sewing, drawing, etc.) often operate as metaphors of childhood (with children as characters “in the making”, and fiction as a means to explore various would-be personae), as well as of the 14 process of writing children’s literature itself (making new stories out of “old” _adult material, piecing parts of a story together…).
Thus, creativity often – always? – involves some degree of recycling. Familiar works of art can be reproduced in different styles; old tales can be retold, sometimes with a twist, challenging old assumptions and offering new interpretations of well-known stories. Re-using old materials – be they stories, objects, tools, toys, etc. – gives them a new lease of life. While concerns with mending and repairing have acquired new relevance in the current eco-anxious context, they also resonate metaphorically with the need to be reassured that human beings, too, can be made whole again, or at least overcome whatever pains they may have had to go through. The healing dimension of engaging in craft and literature will therefore also need to be addressed by the conference.
Possible topics may include (but are not limited to):
- Representations of craftsmanship and creativity in children’s literature and culture
- Figures of childlike or child creators in children’s literature and culture
- Mending objects or people: figures of child healers
- The creative, experimental potential of childhood: children as artists
- Arts and crafts as expressions of the child’s or young adult’s agency and empowerment
- The healing, reconstructive function of children’s books and objects
- Figures of the child or young adult as constructs (cyborgs, hybrid beings, etc.)
- Metaphors of artistic and literary creation, and the metafictive dimension of recycling old materials into new creations
- Writing, illustrating, translating children’s books as fabrication
- Exploring and showcasing the materiality of children’s books (especially in picture books, including sticker-books, pop-up books, leporellos or kamishibai)
- The child as (co-)maker/(co-)author of the book
- Constructing the child through the making/writing of the book
The conference “Making, Building, Mending: Creativity and Craftsmanship in Children’s Literature and Culture” will reflect academic diversity and host studies from across different fields of research, academic methods and cultural backgrounds. We welcome proposals for individual papers as well as panels. We particularly encourage graduate students and other early-career scholars to apply.
Please send an abstract of 500 words and a short biography (100 words) as 2 attached Word documents to cbc2024@univ-rouen.fr before 20 October 2023.
The conference will be held in person.
Panel proposals
Panel proposals should consist of 4 papers that focus on one aspect related to the main theme of the conference. The panel organiser should invite participants and evaluate each paper in the panel, but the panel as a whole and its individual papers will also be reviewed by external evaluators. For a panel proposal, the panel organisers should submit a short overview statement of the panel theme (about 500 words), a list of participants and the abstracts of their papers.
Abstracts
They should include the following information: - author(s) with affiliation(s)
- title and text of proposal
- selected bibliography with 3-5 academic references
- 5 keywords
Submission information
Deadline for submission: 20 October 2023.
Notification of acceptance: December 2023. 15
All submissions are blind reviewed by the members of the Reading Committee.
All abstracts and papers accepted for and presented at the conference must be in English.
Papers will be 20 minutes maximum followed by a 10-minute discussion.
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Gender & Sexualität in der Literatur- und Mediendidaktik
Gender, Diversität und Feminismus sind gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen, die innerhalb der Literatur- und Mediendidaktik noch deutlicher aufgegriffen und reflektiert werden könnten, wohingegen in der Literaturwissenschaft bereits zahlreiche Erkenntnisse der Gender Studies berücksichtigt und Konzepte einer feministischen Literaturwissenschaft entwickelt worden sind (vgl. u. a. Osinski 1998; Schicht 2010). „Das Forschungsfeld der Geschlechterstudien ist von einer Tendenz zur Pluralisierung bzw. Ausdifferenzierung der Ansätze gekennzeichnet, die auch darauf zurückzuführen ist, dass Gender zunehmend in der Verknüpfung mit anderen Faktoren untersucht wird, die über soziale Ungleichheit entscheiden“ (Schößler & Wille 2022, 8). Diese Pluralisierung zeigt sich auch in der literaturdidaktischen Forschung: Die Publikationen der Disziplin bieten gegenwärtig fachgeschichtliche Überblicke (vgl. u. a. Tholen & Stachowiak 2012; Hermes 2019), Konzepte für die Vermittlung literarischer und anderer medialer Texte sowie unterrichtspraktische Modelle (vgl. u. a. Bieker & Schindler 2023; Brendel-Perpina/Heiser/König 2020; Krammer & Malle 2017), während sich die Lesedidaktik seit längerem mit dem Zusammenhang von „Geschlecht und Lesen“ (Philipp 2015) sowie daran geknüpften Differenzen auseinandersetzt (vgl. u. a. Philipp 2011; Pieper 2013; Garbe 2020). Literaturunterricht und -didaktik sowie ihre Einflüsse auf Gender-Konstruktionen werden darüber hinaus kritisch-historisch reflektiert, u. a. mittels Lesebuchanalysen oder im Kontext von Fragen nach Kanon und Curriculum (vgl. u. a. Ott 2017; von Heydebrand & Winko 2005). Und schließlich erhalten in der für die Leseförderung und -sozialisation relevanten Nachbardisziplin der Kinder- und Jugendliteraturforschung die Kategorien Gender und Sexualität verstärkt Aufmerksamkeit (vgl. u. a. Müller et al. 2016; Willms 2022; Seidel 2019; Brenner 2022).
Die hier skizzierten genderorientierten Diskurse zu literarischen und weiteren ästhetischen Medien zeigen einerseits, dass die Forschung zu Gender und Sexualität bereits innerhalb der Lese- und Literaturdidaktik präsent ist, legen andererseits aber auch Desiderate offen. So werden die genannten (Teil-)Disziplinen (Lese- sowie Literatur- und Mediendidaktik, Kinder- und Jugendliteraturforschung, fachhistorische Forschung) noch eher selten miteinander verbunden. Auffallend ist auch, dass es bislang kein breit akzeptiertes Modell des gendersensiblen Literaturunterrichts gibt, was zwar auf die Vielfalt an Termini und Konzepten zurückzuführen ist, für eine gelingende Unterrichtspraxis und deren Untersuchung aber notwendig wäre. Zudem liegen bislang nur wenige intersektionale Arbeiten vor (vgl. u. a. Abrego et al. 2023; Becker & Kofer 2022), die Gender und sexuelle Identität vor dem Hintergrund anderer sozial wirkmächtiger Kategorien wie z. B. Ethnie und Klasse problematisieren, um so bspw. für Marginalisierung zu sensibilisieren. Vor dem Hintergrund des allseits wahrgenommenen medialen Wandels sowie der Pluralisierung der Gesellschaft fehlt es darüber hinaus an Projekten, die die Lese- und Mediensozialisation von Schüler*innen sowie unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen oder Rollenvorstellungen aus diesen Perspektiven fokussieren.
Die Themen Feminismus, Gender und sexuelle Diversität sowie die damit verbundenen Machtstrukturen werden immer präsenter in der Forschung. Die geplante Tagung und die gemeinsame Publikation, die daraus hervorgehen soll, möchten den aktuellen Forschungsstand im Hinblick auf die genannten und weitere Themenfelder resümieren, reflektieren und aufbereiten sowie zur stärkeren intradisziplinäre Vernetzung und Verknüpfung beitragen. Von Interesse ist auch die Frage nach möglichen Verbindungslinien der unterschiedlichen Perspektiven. Des Weiteren sind Beiträge willkommen, die sich den skizzierten Lücken widmen und interdisziplinäre und intersektionale Perspektiven einbringen sowie solche, die die Lese-, Literatur- und Mediendidaktik bzw. angrenzende Institutionen kritisch im Hinblick auf ihr Bewusstsein für Gender und sexuelle Identität beleuchten. Neben empirischen Beiträgen bspw. aus dem Bereich der Lesesozialisation oder der Unterrichtspraxis sind ebenso theoretisch-gegenstandsorientierte Untersuchungen der Kinder- und Jugendliteratur sowie der Literatur-und Mediendidaktik, aber auch fachgeschichtliche Ansätze willkommen. Die folgende Übersicht bietet erste Ideen, aber keinen abgeschlossenen Katalog an Fragestellungen für die Tagung und die gemeinsame Publikation.
Mögliche Themen
- Leseförderung, Lese- und Mediensozialisation
- empirische und theoretisch-konzeptionelle Beiträge zur gendersensiblen Leseförderung
- Leseverhalten und Mediennutzung in Freizeit und Schule bei Jungen und Mädchen (und non-binären Perspektiven)
- empirische und theoretische Auseinandersetzungen mit dem Einfluss von Gender und Sexualität auf die Lese- und Mediensozialisation
Repräsentation von Gender und Sexualität in Literatur und weiteren Medien
- Kanonfragen, Auswahl und Thematisierung der Auswahl in Unterricht, Forschung, Curricula, Schulbüchern usw.
- Identität, Gender und Sexualität in Literatur und weiteren Medien
- Gender und Fachgeschichte
- Geschlechterrollen in der Schule: Geschlechterfragen im Literaturunterricht aus historischer Perspektive
- Schul- und Lesebuchforschung im Kontext von Gender und Sexualität
Für Rückfragen melden Sie sich bitte bei Dr. Jennifer Witte (jennifer.witte@uni-osnabrueck.de) und Dr. Franz Kröber (franz.kroeber@fu-berlin.de).
Vorbehaltlich einer noch ausstehenden Finanzierungszusage ist geplant, die Übernachtungskosten sowie Verpflegungskosten (Mittagsimbiss, Kaffee & Kuchen) für alle aktiv Teilnehmenden in vollem Umfang zu übernehmen und die Beiträge im Anschluss an die Tagung in einem Sammelband zu publizieren. Beiträge von Wissenschaftler*innen in einer frühen Karrierephase sind explizit erwünscht.
Zeitplan
Einreichung von Abstracts (1–2 Seiten) + Kurzbiographie bis zum 20. September 2023 bei Dr. Jennifer Witte (jennifer.witte@uni-osnabrueck.de)
Rückmeldung zu den Abstracts im November 2023
Tagung 26. – 27. Juli 2024 in Osnabrück
Einreichung der fertigen Beiträge für die gemeinsame Publikation bis zum 1. Oktober 2024
Die Veranstalter Jennifer Witte und Franz Kröber freuen sich auf Ihren Beitrag!
Literatur
Abrego, Verónica/Henke, Ina/Kißling, Magdalena/Lammer, Christina & Leuker, Maria-Theresia (Hrsg.) (2023). Intersektionalität und erzählte Welten. Literaturwissenschaftliche und literaturdidaktische Perspektiven. WBG.
Becker, Karina & Kofer, Martina (2022). Zur Intersektionalität von Gender und Race. In Wiebke Dannecker & Kirsten Schindler (Hrsg.), Diversitätsorientierte Deutschdidaktik. Theoretisch-konzeptionelle Fundierung und Perspektiven für empirisches Arbeiten. SLLD-B, Band 4, 69–83.
Bieker, Nadine & Schindler, Kirsten (2023). Deutschdidaktik und Geschlecht. Konzepte und Materialien für den Unterricht. UTB.
Brendel-Perpina, Ina/Heiser, Ines & König, Nicola (2020). Literaturunterricht gendersensibel planen: Grundlagen – Methoden – Unterrichtsvorschläge. Fillibach.
Brenner, Julia (2022). Regenbögen: sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Kinder- und Jugendmedien. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW (AJuM). kopaed.
Garbe, Christine (2020). Lesekompetenz fördern. Reclam.
Hermes, Liesel (2019). Literaturdidaktik und Gender Studies. In Christiane Lütge (Hrsg.), Grundthemen der Literaturwissenschaft: Literaturdidaktik. De Gruyter, 454–470.
Heydebrand, Renate v. & Winko, Simone (2005). Gender und der Kanon der Literatur. Ein problematisches Verhältnis im Überblick. In Hadumod Bußmann & Renate Hof (Hrsg.), Genus. Geschlechterforschung/Gender studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Kröner.
Krammer, Stefan & Malle, Julia (2017). Geschlechter-Inszenierungen. Perspektiven einer performativen Literaturdidaktik. In Ulf Abraham & Ina Brendel-Perpina (Hrsg.), Kulturen des Inszenierens in Deutschdidaktik und Deutschunterricht. Klett, 119–134.
Müller, Karla/Deckert, Jan-Oliver/Krah, Hans & Schilcher, Anita (Hrsg.) (2016). Genderkompetenz mit Kinder- und Jugendliteratur entwickeln. Grundlagen-Analysen- Modelle. Schneider Hohengehren.
Osinski, Jutta (1998). Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Erich Schmidt
Ott, Christine (2017). Sprachlich vermittelte Geschlechterkonzepte. Eine diskurslinguistische Untersuchung von Schulbüchern der Wilhelminischen Kaiserzeit bis zur Gegenwart. De Gruyter.
Philipp, Maik (2011). Lesen und Geschlecht 2.0 Fünf empirisch beobachtbare Achsen der Differenz erneut betrachtet. Leseforum.ch, 1–25.
Philipp, Maik (2015). Geschlecht und Lesen. In Ursula Rautenberg & Ute Schneider (Hrsg.), Lesen. Ein interdisziplinäres Handbuch. De Gruyter, 443–465.
Pieper, Irene (2013). Zur geschlechtsspezifischen Differenz der Leseweisen und Lesestoffe: Wie viel Unterschied sollen/wollen wir machen? In Bea Lundt & Toni Tholen (Hrsg.), „Geschlecht“ in der Lehramtsausbildung. Die Beispiele Geschichte und Deutsch. Lit, 277–295.
Schößler, Franziska & Wille, Lisa (2022). Einführung in die Gender Studies. De Gruyter.
Seidel, Nadine (2019). Adoleszenz, Geschlecht, Identität. Queere Konstruktionen in Romanen nach der Jahrtausendwende. Peter Lang.
Tholen, Toni & Stachowiak, Kerstin (2012). Didaktik des Deutschunterrichts: Literaturdidaktik und Geschlechterforschung. In Marita Kampshoff & Claudia Wiepcke (Hrsg.), Handbuch Geschlechterforschung und Fachdidaktik. VS, 99–112.
Willms, Weertje (2022). Gender in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. De Gruyter.
(Quelle: KunderundJugendmedien.de)
CfP: Internationale Konferenz #YouthMediaLife
Interdisciplinary Perspectives on Digital Practices
Termin: 25. bis 28. März 2024
Ort: Wien
Nach der ersten internationalen Online-Konferenz im Jahr 2021 wird eine Präsenztagung mit Kolleg*innen, die Medienwelten und -praktiken junger Menschen (bevorzugt aus interdisziplinärer Perspektive) beforschen geplant. Seit einigen Jahren bilden die zunehmend komplexen postdigitalen Welten junger Menschen den Fokus der Forschungsplattform #YouthMediaLife an der Universität Wien. Mit der zweiten internationalen Konferenz möchten die Veranstalter*innen ihre interdisziplinäre Arbeit und Vernetzung weiter ausbauen. Dazu laden sie internationale Expert*innen aus verschiedenen Feldern ein, die sich inter- oder multidisziplinär mit den Narrativen junger Menschen auseinandersetzen, die von ihnen, für sie und über sie erzählt werden.
CfP
Die dreitägige Konferenz an der Universität Wien befasst sich vor allem mit den Medienpraktiken junger Menschen und den vielfältigen Fragen, die sich daraus ergeben: In welche Mediatisierungsprozesse sind die Lebenswelten Jugendlicher eingebunden und welchen Einfluss haben diese Prozesse auf die Dynamik zwischen Individualisierung und Gruppenbildung? Wie werden Identitäten durch digitale Medien ko-konstruiert, und welche Rolle spielen dabei Strategien, die Jugendliche bewusst zwischen analogen und digitalen Praktiken wählen lassen? Welche Rolle spielt die Schule als Ort des Erlernens von Medienkompetenzen, aber auch als zentraler Ort, an dem Sozialisierungsprozesse stattfinden? Wie werden narrative Praktiken vom technologischen Wandel verändert, und wie gestaltet sich die Teilhabe der Jugendlichen an diesen Transformationsprozessen?
Welche Muster der Zugehörigkeit und des Ausschlusses in sozialen Medien können identifiziert werden, die die demokratische Teilnahme und politische Handlungsmacht Jugendlicher ermöglichen oder einschränken, und welche demokratischen und inklusiven Ausdrucksformen stehen Jugendlichen heute zur Verfügung? Welche medialen Mittel wählen Jugendliche bevorzugt für die Debatten um ihre Hauptanliegen, wie etwa die Umweltkrise oder der Krieg in Europa? Und wie gehen wir als Wissenschaftler*innen mit dem Tempo um, mit dem sich die globale Medienlandschaft unter dem Einfluss von wirtschaftlichen Umbrüchen, Moden, Trends und sich wandelnden Demographien verändert?
Abstracts können auf Deutsch oder Englisch zu den folgenden Themenbereichen eingereicht werden:
- Wie retten wir die Welt? Das ökologische Engagement der Jugendlichen (Saving the world? Young people’s ecological engagement)
- Die spielen doch nur: Die Rolle von Spielen im Leben von Kindern und Jugendlichen (Just playing: Games and their role in young people’s lives)
- Papier und Bildschirm: postdigitale Lesepraktiken (Paper to screen: post-digital reading practices)
- Auf der Hochschaubahn: Medien und Gefühle (On the rollercoaster: Emotions and the media)
- Dahoam is dahoam: Orte, Räume und mediatisierte Lebenswelten (No place like home: places, spaces and media lifeworlds)
- Medienrepertoires und Medienbiografien: Vernetzungen, Konvergenzen und Diskrepanzen digitaler und nichtdigitaler Medien in der Lebenswelt Jugendlicher (Media repertoires and media biographies: Connections, convergences and discrepancies in young people’s lifeworlds)
- Wir gestalten: Jugendliche Medienakteur*innen als Mediengestalter*innen und Medienentwickler*innen (We design: Young media actors as media designers and developers)
- „Das machen die heutzutage so“: Medienideologien über und von jugendlichen Medienakteur*innen (“That’s how they do it nowadays”: Media ideologies of and about young media actors)
- Partizipativ, Kreativ, Digital: Computational Empowerment in der formalen Bildung (Participatory, Creative, Digital: Computational Empowerment in formal education)
- Mittendrin oder abseits. Bewusste oder unbewusste Ausgrenzungen aus digitalen Medien (In or outside. Conscious or unconscious exclusion from digital media)
- Mit einem Klick neue Welten erobern. Neue Zugänge schaffen durch multimediale Zugänge zur Mediennutzung (Conquering new worlds with a click. Accessibility through multimedia approaches)
- Transparenz und Selbstschutz. Die Privatsphäre in sozialen Medien (Transparency and self protection: The issue of privacy in social media)
- Vom Leserbrief zum Follower. Zum Bedeutungswandel der Mediennutzung (From pen pal to follower: The history of young people’s media use)
- Klüger als wir? Die Gefahren und Potenziale von chat-gpt und anderen (Are we being outsmarted? On the dangers and potentials of chat-gpt and others)
- English spoken: Die Rolle von Englisch im Leben Jugendlicher (English spoken: The role of English in the lives of young people)
- Menschenrechte, Jugendliche und Medien (Human rights, young people and media)
Konferenzbeiträge können auf Englisch oder Deutsch in folgenden Formaten angeboten werden:
- Thematisch zusammenhängende Symposia für 90 oder 180 Minuten (Abstracts mit max. 1000 Wörtern; inkl. Symposiumsabstract und Abstracts für die einzelnen Beiträge; max. 4 Beiträger*innen pro 90 Minuten)
- Interaktive Workshops für 90 oder 180 Minuten (Abstracts mit max. 500 Wörtern)
- Einzelbeiträge: 20 Minuten Vortrag und 10 Minuten Diskussion (Abstracts mit max. 350 Wörtern)
- Poster: Kurzpräsentation in dafür eigens vorgesehenen Foren (Abstracts mit max. 200 Wörtern)
Bitte verwenden Sie für die Einreichung das Formular auf unserer Website
Einreichfrist: 30.06.2023
Weitere Informationen zur Tagung und zur Einreichung finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung)
CfP: „Wissenschaft in zehn Minuten“
Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse 2023
Für die KIBUM 2023 werden erneut Videobeiträge, die sich mit Neuerscheinungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur auseinandersetzen, gesucht. Die Beiträge sollten inhaltlich anspruchsvoll sein und sich einem der beiden Schwerpunkte zuordnen lassen:
a. Didaktische Perspektiven / Vermittlung
In dieser Rubrik sollen Vid- oder Podcasts über kinder- und jugendliterarische Texte präsentiert werden, die 2022 oder 2023 erschienen sind. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Auseinandersetzung mit dem fachdidaktischen Potenzial dieser Texte für literaturspezifische Vermittlungsprozesse in Kindertagesstätten, an Schulen oder Universitäten. Ziel der Vidcasts ist es, (angehenden) Literaturvermittler*innen prägnant und anschaulich zu verdeutlichen, inwiefern diese Texte für die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen und Bereitschaften genutzt werden können. Ebenso kann am Beispiel dieser Texte veranschaulicht werden, inwiefern innovative Verfahren Zugänge zum Gegenstand ermöglichen. Dies schließt auch digitale Zugänge zur Kinder- und Jugendliteratur ein. Adressat*innen dieser Vidcasts sind (angehende) Literaturvermittler*innen, die in unterschiedlichen Institutionen der Literaturvermittlung tätig sind (Schule, Studienseminar, Universität usw.).
b. Literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven
Der zweite Themenschwerpunkt bietet literatur- oder kulturwissenschaftliche Miniaturanalysen ausgewählter kinder- und jugendliterarischer Texte, die 2022 oder 2023 erschienen sind. Hier liegt der Schwerpunkt auf einer analytischen Auseinandersetzung, die textnah einzelne Forschungsfragen skizziert und ggfs. in einen größeren Kontext stellt. Im Zentrum sollten aber stets die zu analysierenden Texte stehen, die unter literatur- oder kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden. Adressat*innen dieser Vidcast sind Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen und fortgeschrittene Studierende.
Die Beiträge dürfen auch literaturkritisch oder essayistisch ausgerichtet sein. Sie sollten ein interessiertes Publikum adressieren. Die Länge der Beiträge sollte ca. 10 Minuten betragen. Denkbar sind auch Abweichungen von dieser Zeitvorgabe, die aber abgesprochen werden müssen. Die Veranstalter würden sich über Beitragsvorschläge von Wissenschaftler*innen, Nachwuchswissenschaftler*innen und fortgeschrittenen Studierenden, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur befassen, sehr freuen.
Das Thema der KIBUM lautet in diesem Jahr: „Grüezi! KIBUM trifft Schweiz“. Beiträge zu Schweizer Kinder- und Jugendliteratur und -medien sind daher explizit erwünscht.
Falls Sie Interesse an der Erstellung eines Vid- oder Podcasts haben, melden Sie sich gerne bis zum 1. Juni 2023 unter Angabe des avisierten Schwerpunkts und des Textes oder der Texte, die Sie im Rahmen Ihres Beitrags thematisieren möchten, bei: Prof. Thomas Boyken (t.boyken@uni-oldenburg.de).
Nach der Annahme des Vorschlags erhalten Sie ein kurzes style sheet. Die fertigen Vidcasts müssen bis zum 15. September 2023 eingereicht werden.
Weitere Informationen erhalten Sie hier.
(Quelle: kinderundjugendmedien.de)
CfP: International Conference
“Against the Tide. Between Niche and Mainstream Publishing”
Date: 23–24 November 2023
Venue: University of Wrocław, Institute of Information and Media Studies (online on MS Teams)
As history shows, publishing activities carried out parallel to the mainstream often have great potential and their impact grows over time, while the digital revolution has brought new opportunities to their creators. During the conference we would like to look at such activities, past and present, undertaken at all stages of the bibliological communication process, considering their social, cultural, economic, or technological environment. Rare, unique and peculiar publications, created between the niche and the mainstream, often escape precise descriptions, theoretical divisions, and sometimes scholarly reflection altogether. Due to their inaccessibility, unusual nature, and low print runs, such publications are a challenging research source – interesting, but at the same time relative and elusive, heterogeneous, and changing over time. They may include not only editions overlooked by the mainstream, considered unattractive, unfashionable because of their subject matter, target group or external form, but also publications actively opposing the mainstream: alternative, experimental, avant-garde, illegal and underground.
We invite papers related to the overall theme of the conference. Possible areas for investigation include but are not restricted to:
- the efforts of authors, illustrators, graphic designers, designers, typographers, printers, bookbinders to give publications an unusual or particularly original form,
- rare books, their collections and collectors, historical book artists and their unusual works,
- contemporary experiments with book form, surprising and extraordinary projects,
- children’s and young adult books: original editions and publishing series, unusual solutions in picturebooks, toy books, educational books,
- publications of various types: books, magazines, newspapers, catalogues, fanzines, digital editions, etc. with characteristic design solutions, publication covers and layouts,
- underground, conspiratorial, illegal and samizdat publishing,
- books and other media: the impact of media convergence, unusual forms of digital publishing, references to the web in books (references, additions, etc.),
- small and niche publishing,
- independent bookselling,
- non-traditional promotional and marketing activities in publishing houses, bookshops and libraries,
- the impact of niche ventures on the mainstream, circulation of initiatives and publications between niche and mainstream publishers.
The conference welcomes papers from international researchers including industry practitioners and PhD students. The conference will be in Polish and English.
Dates and logistics
Deadline for abstract submission: 30 May 2023
Notification of acceptance: 30 June 2023
All submissions are reviewed by the members of the Organizing and Scientific Committee. All abstracts and papers accepted for and presented at the conference must be in Polish or English. Papers will be 20 minutes maximum followed by a 10 minutes discussion.
Please send applications to konf2023inim@uwr.edu.pl using form available in DOC or PDF format.
Organising Committee
Lead Convenor: Ewa Repucho
Secretary: Jan Kaczorowski
Financial Issues: Milena Osowska
Technical Support: Rafał Werszler
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Autorschaft in der Kinder- und Jugendliteratur
Historische und aktuelle Praktiken und Bilder
Termin: 16. bis zum 17.11.2023
Ort: Oldenburg
Die Themen ‚Autorschaft‘ und ‚Inszenierung‘ wurden in den letzten zwanzig Jahren in literar- und kulturwissenschaftlichen Studien umfangreich untersucht. Es erschienen mehrere Publikationen, die jeweils ausgewählte Autor:innen (vgl. Jürgensen/Kaiser 2011, Kyora 2014, Schaffrick/Willand 2014, Fischer 2015) oder einzelne Medienformate analysierten (vgl. Oser 2014, Hoffmann/Kaiser 2014, Sporer 2019, Hoffmann/Wohlleben 2020). In der Forschung gibt es allerdings bislang kaum Beiträge, die sich mit Autor:innen der Kinder- und Jugendliteratur auseinandersetzen (vgl. Lang 2022, Hoffmann 2017, Karnatz 2023). Insofern konstatieren auch Corinna Norrick-Rühl und Anke Vogel im aktuellen Handbuch Kinder- und Jugendliteratur, dass die „Inszenierung von Kinder- und Jugendbuchautoren […] eine Forschungslücke“ ist (Norrick-Rühl/Vogel 2020, 27).
Gleichzeitig dürften die Art und Weise, wie Autor:innen der Kinder- und Jugendliteratur auftreten, wie sie sich inszenieren und inszeniert werden, welche ‚Marke‘ sie repräsentieren, für die Wahrnehmung der Texte und für die Bindung der Leserschaft an die/den Autor:in von großer Bedeutung sein. Schließlich hat sich im Sozialsystem bzw. Subfeld Kinder- und Jugendliteratur bereits früh ein eigener Teilmarkt mit eigenen Regeln herausgebildet. Hier kann man sinnvoll an gängige Systematisierungen anknüpfen, um hier auch die Bedeutung von Autor:innen näher zu betrachten (vgl. Hurrelmann 1992, Ewers 2012 und 2021, Gansel 2019). Mit in der Kinder- und Jugendliteraturforschung bislang wenig beachteten Rahmentheorien – wie etwa der Feldtheorie Pierre Bourdieus oder den Überlegungen zum ‚Subjekt‘ von Andreas Reckwitz – könnte die Forschung zudem erweitert werden (vgl. Tommek 2015, Kyora 2014). Im Anschluss daran wäre zu prüfen, welche Medien im Feld der Kinder- und Jugendliteratur häufig für die Erzeugung von Aufmerksamkeit genutzt wurden und heute genutzt werden. Hier lässt sich ein Wandel beobachten, der insbesondere mit den digitalen Medien im Zusammenhang steht. Denn selten waren Autor:innen als Medienfiguren so sichtbar wie heute, die dokumentierten Schritte ihrer Schreibarbeit und der Austausch zwischen ihnen und ihren Leser:innen – zum Beispiel über soziale Medien – so leicht nachvollziehbar. Autor:innen treten nicht mehr nur über das klassische (Schwarz-Weiß-)Foto auf der Buchrückseite öffentlich auf, sondern präsentieren sich in privaten und fiktiven Welten – wie etwa Cornelia Funke, deren Homepage über längere Zeit ihrem Garten- und Schreibhaus nachgeahmt war.
Bei diesen Inszenierungspraktiken entstehen Bilder/Images von Autor:innen, die es im Einzelnen näher zu untersuchen gilt. In dem Zusammenhang ist auch der Frage nachzugehen, welche Modelle sich innerhalb der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur herausbildeten (wie etwa der „kinderliterarische Erzähler“, Gansel 2019, 37). Partizipieren Bilder von Autor:innen in der Kinder- und Jugendliteratur an den Modellen von Autorschaft, die auch in der Allgemeinliteratur dominant sind? Gibt es auch in der Kinder- und Jugendliteratur poeta doctus oder poeta vates (vgl. Hoffmann/Langer 2013)?
Unsere Tagung orientiert sich insofern an drei Themenkomplexe. Folgende Fragen möchten wir im Rahmen unserer Tagung diskutieren:
- Praktiken und Bilder
- Wie tritt ein:e Autor:in als Kinder- und Jugendliteraturautor:in auf?
- Was sind (typische) Inszenierungspraktiken von Kinder- und Jugendbuchautor:innen?
- Welche Inszenierungspraktiken sind in unterschiedlichen Zeiten (vom 18. bis zum 21. Jahrhundert) dominant? Gibt es Veränderungen und Kontinuitäten?
- Mithilfe welcher Medien werden Bilder von Kinder- und Jugendbuchautor:innen sichtbar? Sind medienspezifische Bilder zu erkennen?
- Lassen sich Rückschlüsse auf mögliche Identifikationsangebote mit den potenziellen Leser:innen ziehen?
- Welche ‚Funktion‘ besitzt ein Bild/Image für einen kinder- und jugendliterarischen Text?
- Buchmarkt / Vermarktung
- Inwiefern ist die Inszenierungspraktik auch im Kontext von Marketing und Vermarktung von Kinder- und Jugendliteratur von Bedeutung?
- Haben sich die Bilder im Zuge der Entwicklungen des kinder- und jugendliterarischen Markts verändert?
- Welche Bedeutung spielen einzelne Akteur:innen des Teilmarkts (Verlage, Agenturen, Vermittler:innen) für die Inszenierungspraktiken und Bilder?
- Subsystem / Subfeld
- Lassen die Praktiken und Bilder darauf schließen, dass Kinder- und Jugendliteratur als Subsystem bzw. als spezifischer Feldbereich (im Sinne Bourdieus) zu begreifen ist?
- Gibt es Spezifika von Nationalliteraturen (Schweiz, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik, Österreich, USA usw.)?
Wir laden Forscher:innen aus verschiedenen Disziplinen dazu ein, sich mit diesen Fragen zu befassen.
Über Beitragsvorschläge in Form eines ca. einseitigen Abstracts (inkl. einer Kurzvita) freuen wir uns. Senden Sie Ihre Abstracts bitte an: ella.margaretha.karnatz@uol.de. Die Einreichung von Abstracts ist bis zum 20.4.2023 möglich. Die Auswahl der Beiträge erfolgt durch ein Review-Verfahren.
Die Tagung wird von der OlFoKi (Oldenburger Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur) und vom SIKJM (Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien) im Rahmen der KIBUM (Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse) ausgerichtet. Das Thema der KIBUM lautet in diesem Jahr „Grüezi! KIBUM trifft Schweiz“. Beiträge zu Schweizer Autor:innen von Kinder- und Jugendliteratur sind daher explizit erwünscht. Reise- und Unterkunftskosten werden erstattet.
Tagungsleitung: Prof. Dr. Thomas Boyken und Ella Margaretha Karnatz
(Quelle: H-Net)
CfP: Radical Children's Film and Television
Edited Collection
The Editor is seeking chapter proposals for possible inclusion in a forthcoming volume exploring radical children’s film and television. This edited collection is intended as an inaugural volume in the new ‘Children’s Film and Television’ book series, published by Edinburgh University Press.
On the surface, there might appear to be an incompatibility between children’s media and radical thought. If much of the import of children’s fiction lies in the inculcation of received ideologies about how societies and individuals comport themselves – ideologies that are naturalised and, therefore, largely invisible – then it follows that children's culture often aligns with such values. Certainly, ideas of radicalism in children's film and television are impossible to reconcile with influential claims that children's media merely reproduces conservative ideas of culture and society. But such perspectives fail to account for diverse and surprisingly prevalent traditions of children’s film and television that deliberately challenge political and aesthetic orthodoxies, often under a cloak of innocence.
In recent years, a good deal has been written on the topic of radical children’s literature. However, very little attention has been paid to radical children’s film and television. This volume aims to redress the balance. Rather than advancing binary definitions, the focus is on film and television that can be seen as radical in context of the social, political and aesthetic norms in which it is produced. It will also centre on ideas of radical potential – the ways that film and TV represent radical content or philosophies in whole or in part, and the potential uses of this content by individuals, communities of fandom, political groups, and creative practitioners.
The volume will be interdisciplinary in scope and the call is open to contributions from across a range of theoretical or methodological approaches. The Editor is receptive to proposals that seek to examine shorts and features; individual episodes and entire series; punctuating moments of radicalism in otherwise apparently ‘conventional’ productions; live-action and animation of all types; and documentary (including educational films) as well as fiction. The scope is international and proposals may cover any historical period.
Possible themes and topics might include (but aren’t limited to):
- Avant-garde aesthetics in children’s film and TV
- Challenges to dominant ideologies across the political spectrum
- Film and television for young audiences that deal with taboo issues usually considered off-limits for children
- Film and television that engage children as active citizens empowered to change the world
- Audiences (including fans) radicalising children’s film/TV, e.g. through queering, parodying, or adopting it for social, cultural or political subversion
- Children/young people as producers of radical screen media
More information on the ‘Children’s Film and Television’ series can be found here.
Please send proposals (including abstracts of 400-500 words, and a biography of 50–80 words), to Noel Brown at brownn@hope.ac.uk by Sunday 30 April 2023.
Edited by Dr. Noel Brown (Liverpool Hope University)
(Quelle: Aussendung)
CfP: “Fantastic antiquities and where to find them. Ancient worlds in (post-)modern novels”
special volume of thersites (Journal for transcultural presences & diachronic identities from antiquity to date)
“Fantastic antiquities and where to find them. Ancient worlds in (post-)modern novels” (Summer 2024) edited by Christine Walde, Concetta Finiello, Matthias Heinemann and Adrian Weiß.
In recent years, in all languages there has been a significant increase in the number of novels set in antiquity, ranging from retellings of ancient myths and legends and historical fiction to speculative fantasy.These novels have captured the imagination of readers and scholars alike, offering new and challenging insights into the social hierarchies, gender roles, and cultural practices of ancient societies (especiallyGreece, Rome and the Roman provinces, Egypt, Mesopotamia, and theNear East).
The Editors welcome original research articles, essays, interviews, book reviews on any topic related to modern/contemporary novels (period: 1900-2023) engaging with antiquity. Personal reflections by authors of novels are also welcome.
Possible topics for submission include, but are not limited to:
- Survey articles on the multiple use of specific ancient texts or figures in modern novels (e.g., Troy in general, Odyssey,Penelope, Nero, Caesar, Ovid, Julian Apostata etc.).
- The representation of gender and sexuality in contemporary literature set in antiquity.
- Race and social hierarchies in these novels.
- The use of intertextuality and narrative techniques in retelling ancient stories.
- The motivations of contemporary authors in setting their novels in antiquity.
- The educational backgrounds of authors and their influences on the depiction of ancient societies.
- The relationship between contemporary literature and academic research on antiquity. This includes novels starring professionals of our disciplines (teachers, graduates, professors).
- The ways in which the marketing of these novels reflects changing cultural attitudes toward the past.
- The role of these novels in shaping contemporary political discourse.
- The use of these novels in teaching the antiquities.
Papers (in English, German, French, Italian, Spanish, Latin) should be original and unpublished elsewhere.
Please follow the guidelines for authors on our website.
Please send an abstract of max. 250 words (short bibliography included) and a brief author bio as soon as possible but not later than April 30, 2023 to Christine Walde (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) waldec@uni-mainz.de.
(Quelle: Aussendung)
CfP zum Herbstseminar "Visual Literacy"
"Bildgewaltig. Illustration ist mehr als Beiwerk"
Termin: 24. bis 26. November 2023
Ort: Katholisch-Sozialen Institut, Siegburg
CfP
Illustration ist weit mehr als ein Beiwerk. – Bilder erzählen selbst Geschichten, interpretieren und flankieren Texte, gebe ihnen neue Bedeutungsebenen. Bilder verstärken den Leseeindruck und bleiben in Erinnerung. Das gilt – entgegen gängiger Vorurteile – schon lange nicht mehr nur für Kita- Kinder oder Leseanfänger*innen. Das Erzählen und das Lesen (auch) in Bildern begeistert alle Altersgruppen. Der Vormarsch der Graphic Novels eröffnet zudem eine faszinierende thematische und ästhetische Bandbreite. Die Buch-Illustration steht heute für eine enorme Experimentierfreude, eine große künstlerische Bandbreite.
Gerade in unserer medialen und digitalen Welt braucht es aber besondere Kompetenzen im Umgang mit Bildern, Stichwort Visual Literacy. Denn auch Bilder zu lesen, zu deuten und zu hinterfragen, will gelernt sein. Mit diesem Seminar möchten wir der (narrativen) Wirkung von Bildern nachspüren und ihr Potenzial für die Literaturvermittlung ausloten. Zugleich soll der Blick auf Rahmenbedingungen und Trends der Buchillustration gerichtet werden. Was ist neu, was sorgt für Diskussionsstoff und was sind Kriterien für ein gelungenes Erzählen in Text UND Bild?
Folgende Aspekte sollen betrachtet werden:
- Wo steht das Bilderbuch heute? Jüngste Entwicklungen, ästhetischer Anspruch, Trends und Debatten
- Visual Literacy. Vom Pappbilderbuch bis zum Erstlesecomic, von der Graphic Novel zu bibliophil illustrierten Texten – Ansprüche und Dechiffriermöglichkeiten der verschiedenen Formate
- Illustration in der Kritik. Welches Rüstzeug braucht es, um Bilder bewerten zu können?
- (Kinder)Comics voll im Trend. Kritisch, realistisch, autobiografisch – ein Genre in neuer Blüte
- Wissensvermittlung auf einen Blick. Illustrationen im Sach(bilder)buch
- Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Potenzial und Herausforderungen textloser
- Bilderbücher
- Du sollst Dir (k)ein Bild machen. Not, Krieg, Trauma, Verwüstung - das Unsagbare ins Bild
- setzen
- Gut gemacht statt gut gemeint: Diversität ohne Alibifunktion im Bilderbuch
- rau Deinen Augen nicht. Wie Farbe, Perspektive und Bildausschnitt die Bildaussage
- beeinflussen
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Pädagog*innen/Lehrkräfte, Bibliothekar*innen, Buchhändler*innen, Journalist*innen, Autor*innen, Illustrator*innen, Verlagsmitarbeiter*innen sowie weitere Multiplikator*innen von Kinder- und Jugendliteratur.
Mögliche Formate:
- Hauptvortrag (45 Minuten),
- Kurzvortrag (30 Minuten),
- Workshop (ca. 3 Stunden)
- Lesung / Werkstattbericht
Abstracts, max. 1.500 Zeichen:
Neben einer Inhaltsskizze zu einem der oben genannten Aspekte wird um einen Arbeitstitel, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund) gebeten.
Einsendeschluss: bis 30. Januar 2023 an bernd@jugendliteratur.org
Veranstalter: Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
(Quelle: Aussendung + CfP)
CfP: The Picturebook between Fiction and Reality
The 9th International Conference of the European Network of Picturebook Research "The Picturebook between Fiction and Reality" will be held in Osijek, Croatia on 28 – 29 September 2023.
The general theme of the conference addresses the complex relationship between fiction and reality as a topic that is highly relevant for the picturebook format. Drawing on Barbara Bader’s famous definition (1976: 1), we may state that the picturebook as an art form hinges on the interdependence of fiction and reality. Our intention is to initiate a discussion of various aspects of this relationship in picturebooks and to explore the status of the picturebook as a kind of artefact in regard to these two realms.
In picturebooks, this relationship can be observed from different angles, such as semiotic structure, the fiction-nonfiction divide, materiality, metafiction, the reading process, and others. The semiotic structure of the picturebook depends on the ways meanings are conveyed through pictures and words. We may explore which elements of these two media are real (fonts, design, three-dimensionality, covers, etc.), and which of them are purely fictional (characters, settings, actions). Regarding the fiction-nonfiction divide itself, fiction picturebooks often populate their worlds with people, objects or artefacts from the real world. On the other hand, nonfiction picturebooks may include fictional elements, such as fairies alongside chairs in alphabet books. Possible combinations of these elements create specific meanings. Besides, research has shown that the picturebook uses its materiality to convey meanings, which makes it a real object on the threshold of reality and fiction. It would be useful to explore how they coexist, and how the materiality of picturebooks as real-life objects challenges or supports their fictional content. This is only one way in which picturebooks expose their metafictionality, and their customary self-consciousness and frequent self-referentiality make it even more obvious. Finally, the "drama of the turning of the page" (Bader 1976: 1) puts the reader and the picturebook into a specific relationship to each other. The dialogue between the two picturebook discourses, words and pictures, can only happen in the process of reading. It is thus important to consider how reality and fiction meet in this process.
The organizers hope that the conference will encourage them to explore how picturebooks raise some of the deepest existential questions through various encounters of fiction and reality, and how they do so in a way that is attainable to every reader, regardless of age. We also wish to better understand the ways in which picturebooks provide both an early aesthetic experience of the world and an important space for unique and differing perspectives throughout a lifetime, especially through their twofold, parallel existence in the domains of the real and the fictional.
The organizers invite papers related to the overall theme of the conference. Possible areas of investigation include, but are not restricted to:
- The picturebook as a format (art form) between fiction and reality
- Materiality of picturebooks: where do fiction and reality meet?
- Visual and verbal intertextuality: referring to fact and referring to fiction
- Visual and verbal (narrative) strategies exposing the fictionality of picturebooks
- Fictional elements in nonfiction picturebooks: real or fictional?
- Factual elements in fictional picturebooks, their importance and their meanings
- Fantastic and realistic fiction vs. reality in picturebooks
- Cultural and historical facts and their impact on content interpretations (also in translation)
- Reading the picturebook as a process of establishing a relationship between fiction and reality
- Kinds of interactivity of picturebooks and the subtle borderline between fiction and reality.
Submission
Please send an abstract of 300 words maximum and a short biography of 100 words as two attached Word documents to ENPRconf2023@gmail.com. E-mails should have the subject line: Submission Picturebook Conference 2023.
Abstracts should include the following information:
1. Author(s)
2. Affiliation as you would like it to appear in the programme
3. City and country
4. E-mail address
5. Title of proposal
6. Text of proposal
7. Five keywords
8. Selected bibliography with academic sources (3-5 references)
9. Area(s) of investigation (in reference to those suggested above)
Key information
- All abstracts and papers must be in English
- Deadline for abstract submission: 15 February 2023
- Notification of acceptance: 31 March 2023
- All submissions are blind reviewed
- Submit to ENPRconf2023@gmail.com
Up to 40 proposals will be accepted for the conference based on their relevance for the general conference theme, originality and the overall quality of the proposal.
Papers will be 20 minutes maximum followed by a 10-minute discussion.
Conference fee
Early bird fee: EUR 100 to be paid by 15 June 2023
Student and retiree early bird fee: EUR 70 to be paid by 15 June 2023
Regular fee: EUR 130
Reading Committee/Advisory Board
Evelyn Arizpe (University of Glasgow, United Kingdom)
Małgorzata Cackowska (University of Gdansk, Poland)
Marnie Campagnaro (University of Padova, Italy)
Yael Darr (Tel Aviv University, Israel)
Elina Druker (University of Stockholm, Sweden)
Nina Goga (Western Norway University of Applied Sciences in Bergen, Norway)
Bettina Kümmerling-Meibauer (University of Tübingen, Germany)
Smiljana Narančić Kovač (University of Zagreb, Croatia)
Organising Committee
Smiljana Narančić Kovač (University of Zagreb, Croatia), chair
Željka Flegar (University of Osijek, Croatia)
Bettina Kümmerling-Meibauer (University of Tübingen, Germany)
Sanja Lovrić Kralj (CARCL president, University of Zagreb, Croatia)
Ivana Milković (University of Zagreb, Croatia)
Ivana Marinić (University of Osijek, Croatia)
Vedrana Živković Zebec (University of Osijek, Croatia)
Nikola Novaković (University of Zagreb, Croatia), secretary
About the conference
The European Network of Picturebook Research was established during the first picturebook conference in Barcelona in September 2007.
The network was proposed by Bettina Kümmerling-Meibauer (University of Tübingen, Germany), who was a member of both the reading committee and co-organiser of the Barcelona conference, and of the core group of picturebook researchers, which includes or has included Evelyn Arizpe, Nina Christensen, Teresa Colomer, Elina Druker, Maria Nikolajeva and Cecilia Silva-Díaz.
Since then, biannual picturebook conferences have been held in different European countries:
- 2007 at the University of Barcelona, organised by Teresa Colomer and Cecilia Silva-Díaz (New Impulses in Picturebook Research: Aesthetic and Cognitive Aspects of Picturebooks)
- 2009 at the University of Glasgow, organised by Evelyn Arizpe and Maureen Farrell (Beyond Borders: Art, Narrative and Culture in Picturebooks)
- 2011 at the University of Tübingen, organised by Bettina Kümmerling-Meibauer (History and Theory of the Picturebook)
- 2013 at the University of Stockholm, organised by Elina Druker (Picturebooks as Meeting Places: Text, Image, Ideology)
- 2015 at the University of Gdansk, organised by Małgorzata Cackowska (Picturebooks, Democracy and Social Change)
- 2017 at the University of Padova, organised by Marnie Campagnaro (Home and Lived-In Spaces in Picturebooks from the 1950s to the Present)
- 2019 at Western Norway University of Applied Sciences (HVL) in Bergen, Norway, organised by Nina Goga, Sarah Hoem Iversen and Anne-Stefi Teigland (Verbal and Visual Strategies in Nonfiction Picturebooks)
- 2021 at Tel Aviv University, Israel, organised by Yael Darr (Picturebooks in Time)
The aims of these conferences are
1. to foster international picturebook research
2. to promote young researchers who are focusing on the investigation of picturebooks
3. to publish selected papers presented at the conferences through international publishers or in peer-reviewed journals.
(Quelle: kinderundjugendmedien)
CFP: Otfried Preußler, Reichenberg/Liberec
Für die internationale Tagung zu Leben und Werk Otfried Preußlers vom 19. bis 21. Oktober 2023 in Reichenberg/Liberec wird um Themenvorschläge zu medialen und transkulturellen Kontexten in Leben und Werk des Kinderbuchautors gebeten.
2023 jährt sich der Geburtstag des bekannten Kinderbuchautors Otfried Preußler zum 100. Mal. Geboren am 20. Oktober 1923 in Reichenberg/Liberec, wo er 1942 Abitur machte, kam er zur Wehrmacht und geriet an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. 1949 entlassen, ging er ins bayerische Rosenheim und wurde Lehrer im benachbarten Stephanskirchen. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend (Erntelager Geyer, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit Der kleine Wassermann, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion (Deutscher Jugendbuchpreis). Im Jahr darauf folgte Die kleine Hexe, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz (zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus). Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor hingegen in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Bald schon kam es zu intermedialen Adaptionen in Hörspielen, Puppentheater und Verfilmungen (u.a. 1974 Der Räuber Hotzenplotz, 1977 Čarodějův učeň/Krabat, 2008 Krabat, zuletzt 2018 Die kleine Hexe).
Anlässlich des Jubiläums soll Otfried Preußlers Leben, sein Werk und seine Rezeption in einem breiten kulturhistorischen Kontext in einer internationalen Tagung in Reichenberg gewürdigt werden. Neben Beiträgen zu seinem (familiären) Hintergrund, seiner Jugendzeit in Reichenberg und seinen Verlags-, Übersetzungs- und Redaktionsnetzwerken (auch) während des Kalten Krieges sollen interkulturelle Kontexte in Bayern, Böhmen und der Lausitz (Der Räuber Hotzenplotz, Der kleine Wassermann, Krabat etc.) sowie die mediale Verarbeitung seiner Bücher im Mittelpunkt stehen. Die Werke für Erwachsene (Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil, Ich bin ein Geschichtenerzähler) wären im Kontext der deutschsprachigen Vertriebenenliteratur zu betrachten. Preußlers internationale Rezeption (etwa durch Übersetzungen) auch jenseits seiner Heimatländer sind ebenso zu berücksichtigen wie die (Nicht-)Akzeptanz Preußlers in Tschechien nach 1989.
Der Call for Papers richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus historischen, literatur- und kunstwissenschaftlichen sowie allgemein kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Es wird um Skizzen (bis zu ca. 2.000 Zeichen) für Vorträge mit einer Länge von 20 Minuten gebeten. Abstracts können auf Deutsch, Tschechisch und Englisch eingereicht werden. Bitte senden Sie die Skizze versehen mit Ihrem Namen, Ihrem Titel und dem Namen Ihrer Forschungseinrichtung und der Angabe Ihrer Forschungsschwerpunkte bis zum 15. Februar 2023 an einen der Organisatoren. Die Veranstalter tragen die Reise- und Unterbringungskosten. Eine Benachrichtigung über die Annahme des Vortrags erfolgt bis Mitte März 2023. Die Publikation der Beiträge ist vorgesehen.
Veranstalter:
Adalbert Stifter Verein, München; ÚČL AV ČR; Krajská vědecká knihovna v Liberci in Kooperation mit der Technischen Universität in Liberec (tbc)
Konzeption und Organisation der Tagung:
Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein (mayer@stifterverein.de)
Dr. Václav Petrbok, ÚČL AV ČR (petrbok@ucl.cas.cz)
Einsendeschluss für die Themenvorschläge: 15. Februar 2023
(Quelle: H-Germanistik)
CfP Romanistentag 2023 - Sektion 21: "Präsenz des Buches, Virtualität der Lektüre"
Kinder- und Jugendliteratur im romanischen Fremdsprachenunterricht
Der Deutsche Romanistenverband organisiert alle zwei Jahre den Deutschen Romanistentag. Er wird jeweils an einem anderen romanischen Seminar ausgerichtet und besteht aus ca. 25 Sektionen sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher sowie didaktischer Ausrichtung.
Dieses Jahr wird der 38. Romanistentag vom 24. bis 27. September in Leipzig, unter dem Thema "Präsenz und Virtualität", stattfinden.
CfP Sektion 21: "Präsenz des Buches, Virtualität der Lektüre"
Ungeachtet veränderter Grundbedingungen des Lernens und Lehrens an Schulen und Hochschulen zählt das Lesen nach wie vor zu den unbestrittenen Grundfertigkeiten von Sprachnutzern; auf allen Niveaustufen ist das Leseverstehen ein basales Bildungsziel des fremdsprachlichen Unterrichts geblieben.
Mit der Sektion ist der Wunsch nach einer Rückkehr zum Lesen verbunden, dessen Attraktivität für junge und potentielle Leser*innen mittels wertvoller kinder- und jugendliterarischer Texte durchaus gesteigert werden kann – denn als Erwachsener liest nur, wer schon vorher Freude daran hatte. Als Forschungssektion wendet sie sich an die universitäre und akademische Gemeinschaft, um neue didaktische Konzepte und Programme für Fremdsprachenlernende zu entwickeln und mit dem doppelten Ziel zu erarbeiten, das Erlernen einer romanischen Fremdsprache mit der (Wieder-)Entdeckung mehr oder weniger kanonischer Texte der Literatur eines romanischen Zielsprachenlandes sinnvoll zu verbinden. Da sich im Laufe der Zeit Lektüre- und Rezeptionsstrategien stark verändert haben, möchte die Sektion den Blick auch auf eine multimedial ausgerichtete KJL richten und jenseits der traditionellen Lektüre auch die Rezeption von Comics, Graphic Novels, Bilderbüchern, Reimen und Gedichten, Liedern, Hörspielen und Podcasts etc. untersuchen. Diese und weitere mediale Darbietungsformen erleichtern das Erlernen einer Fremdsprache besonders hinsichtlich komplexer Inhalte durch eine zugänglichere (Bild-)Sprache, verlangen aber auch veränderte Wege der Wahrnehmung und Annäherung, Analyse und Vermittlung. Entsprechend dem erweiterten Literaturbegriff aktueller Lehrpläne, also jenseits der Höhenkammliteratur und der Kanones – ohne jedoch diese ganz aufzugeben –, soll auch gezielt die didaktische Aufbereitung von medialen Mischformen und Adaptionen von ‚Klassikern‘ Berücksichtigung finden. Dies bietet darüber hinaus auch Möglichkeiten, die Ästhetik von Texten neu zu erleben und zu bewerten.
Die Sektion möchte theoretische, unterrichtspraktische und methodische Aspekte gewinnbringend miteinander verzahnen und den wichtigen interinstitutionellen Dialog zwischen diesen verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen in Gang setzen. Mit Blick auf die universitäre Lehrerbildung sollen hochschuldidaktische Impulse gesetzt und zukünftige Lehrpersonen im Austausch mit Kolleg*innen anderer Sprachen und Disziplinen durch neue Ideen gestärkt werden.
Im Rahmen der Sektion sollen z.B. folgende Aspekte eine nähere Betrachtung erfahren:
- phantasievoller, bildungsrelevanter Umgang mit Klassikern der KJL (z.B. Fortsetzung, Parodie, Medienwechsel)
- textzentrierte Konzepte der Leseförderung unter Berücksichtigung des spezifischen fremdsprachendidaktischen Bedarfs
- Erweiterung des Spektrums der Lesestrategien um hörverstehenszentrierte Ansätze sowie Motivation zur schriftlichen Textproduktion
- aktivierende kreative und handlungsorientierte Ansätze der Literaturdidaktik, welche die KJL in verschiedenen medialen Darbietungsformen einbeziehen: Bücher, Comics, Graphic Novels, Reime, Lieder, Podcasts etc.
- die ästhetisch-pragmatische Abwägung und kritische Reflexion über den Bildungsgehalt von Adaptionen und didaktisierten Ausgaben kinder- und jugendliterarischer Texte für die Lektüre im fremdsprachlichen Unterricht
- innovative Ideen für die altersgerechte Adaption von KJL im Fremdsprachenunterricht
- angemessene gattungsbezogene Rezeptionsweisen (szenisch, rezitatorisch, narrativ, gestisch etc.)▪ autoreferentielle Texte der KJL, die eine formorientierte Textrezeption ermöglichen
- ästhetische, kunstpädagogische und musikalische Zugänge zu kinder- und jugendliterarischen Texten
- Figuren der französischen, italienischen und spanischen Kinder- und Jugendbuchkultur und ihre Transformationen in Buch und Medienverbund
- nationale und europäische Identität und Erinnerungskultur in der KJL
- romanische Spezifika und interkulturelle Begegnungen in Texten der KJL
- historische und kulturgeschichtliche Themen und Fragestellungen in der KJL
- transkulturelle Entgrenzungen und Reflexionen in der KJL
- Tabuthemen (Tod, Krankheit etc.) in der KJL (und ihre kulturelle Spezifizität)
- Umgang mit Gender- und Diversitätsaspekten in KJL
- übersinnliche und übernatürliche Phänomene in der KJL und ihre Darstellung in verschiedenen Medien
- das Potential von Übersetzungen kinder- und jugendliterarischer Werke für mehrsprachigkeitsorientierte Unterrichtsarrangements
Details zur Einreichung von Vortragsvorschlägen
Die Organisator*innen freuen sich über die Zusendung von Abstracts (maximal 500 Wörter zuzüglich
Auswahlbibliographie) und kurzen biobibliographischen Angaben (max. 300 Wörter) im Word-
oder PDF-Format in einer der Vortragssprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch,
Englisch) bis spätestens 31. Januar 2023 an die Sektionsleitung:
Ornella Kraemer: ornella.kraemer@uibk.ac.at
Roland Ißler: issler@em.uni-frankfurt.de
(Quelle: Aussendung)
CfP: libri liberorum - Heft 61
themenoffenes Heft
Libri liberorum, die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung, wurde im Jahr 2000 als Mitteilungsblatt der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF) gegründet, 2010 in eine wissenschaftliche und 2016 in eine peer reviewte Zeitschrift umgewandelt. Ab der 51. Ausgabe erscheint sie open access. Das Ziel der Zeitschrift ist die Erforschung der historischen und aktuellen Kinder- und Jugendliteratur mit Schwerpunkt auf Themen über und aus Österreich. Sie dient als Kommunikationsplattform und als Informationsforum für ExpertInnen und Interessierte im In- und Ausland. Neben wissenschaftlichen Fachbeiträgen werden auch Projektberichte, Miszellen und Rezensionen angenommen.
Nach einigen themenspezifischen Heften (siehe auch hier) möchten wir die nächste themenoffene Ausgabe für spannende Forschungsergebnisse im Bereich historischer oder zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur und -medien öffnen und freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch bis zum 1. März 2022, die fertigen Beiträge bis zum 1. Juli an: oegkjlf@univie.ac.at
CfP (de&en)
Das Redaktionsteam
Susanne Blumesberger
Petra Herczeg
Stefan Krammer
Wynfrid Kriegleder
Susanne Reichl
Sonja Schreiner
CfP zur Herbsttagung der ÖG-KJLF 2023
Verlängerung der Einreichfrist: 15. März 2023
100 Jahre Vera Ferra-Mikura: Netzwerken im österreichischen Kinder- und Jugendliteraturbetrieb zwischen 1945 und 1980
Termin: 13. Oktober 2023
Ort: Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK), Berggasse 17, A-1090 Wien
CfP
Die Wienerin Vera Ferra-Mikura (1923-1997), als Lyrikerin in der von Otto Basil herausgegebenen Zeitschrift Plan entdeckt, ab 1948 als freie Schriftstellerin tätig und Teilnehmerin an zahlreichen Veranstaltungen der Nachkriegszeit, fiel zunächst als Autorin origineller und satirischer Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften auf, bevor sie sich ab den späten 1940er Jahren vermehrt der Kinder- aber auch der Jugendliteratur, ihrer Meinung nach einem Teilbereich der Literatur, widmete. Sie zählte zu den bedeutendsten österreichischen Lyrikerinnen und Erzählerinnen, Rudolf Felmayer nannte sie „die beste junge Dichterin neben Christine Busta“ (Neue Wege, 1959/60, 92). Sie verfasste auch Hörspiele, Romane, Haikus und war Meisterin des Sprachspiels. Die österreichische Kinder- und Jugendliteratur verdankt ihr die ersten phantastischen Erzählungen. Man nannte sie die „Astrid Lindgren von Österreich“ (Anzeiger des österreichischen Buchhandels, Nr.4/1983).
Ihre Erfolge und ihre Beliebtheit spiegeln sich in einer Fülle an Auszeichnungen wider, unter anderem erhielt sie zwischen 1956 und 1983 neun Mal den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien; 1962, 1963, 1964 den Österreichischen Staatspreis für Kleinkinderbücher, 1971, 1973, 1983/84 den Österreichischen Staatspreis für Kinderbücher; 1988 die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien für bedeutende Leistungen. 34 ihrer Kinderbücher, die zumeist in den Verlagen Jugend & Volk und Jungbrunnen, im Festungsverlag und bei Kremayr & Scheriau erschienen sind, standen auf der Ehrenliste des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und des Kulturamtes der Stadt Wien. Ferra-Mikura war in zahlreichen Schriftsteller*innenverbänden aktiv und dementsprechend mit zahlreichen Kolleg*innen in regem Austausch, unter ihnen Käthe Recheis, Brigitte und Wilhelm Meissel, Friedl Hofbauer, Oskar Jan Tauschinski und Kurt Wölfflin. Aber auch mit vielen der zahlreichen Illustrator*innen, mit denen sie zusammenarbeitete, darunter etwa Romulus Candea, war sie freundschaftlich verbunden.
Vera Ferra-Mikura prägte mit zahlreich neuaufgelegten und in viele Sprachen übersetzten Werken mehrere Generationen jüngerer und älterer Kinder: So gab sie mit Zaubermeister Opequeh (1956) den ersten Impuls für das Genre der phantastischen Erzählung in Österreich, schuf mit Der alte und der junge und der kleine Stanislaus (1962) einen zeitlosen Klassiker und griff bisherige Tabus in der Kinderliteratur auf, etwa das Thema Scheidung in Peppi und die doppelte Welt (1963), körperliche Einschränkungen in Simon und Sabine von der Burgruine (1978) und Alter in Die Oma gibt dem Meer die Hand (1982). Ihre liebenswerten Figuren sind zum Teil noch heute unvergessen.
Eine Tagung am 13. Oktober 2023 am Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK) soll sich mit der Rolle, die Vera Ferra-Mikura im österreichischen Literaturbetrieb fünf Jahrzehnte lang spielte, beschäftigen und verschiedene Aspekte aufgreifen.
Wir freuen uns auf Einreichungen zu Themen wie:
- Zusammenarbeit mit anderen Autor*innen, mit Verlagen und Illustrator*innen
- Spuren des Wirkens von Ferra-Mikura in der zeitgenössischen österreichischen, aber auch internationalen Literatur
- Nachhaltigkeit der von Ferra-Mikura aufgegriffenen Themen und Niederschlag in den heutigen Jugendmedien
- Aktuelle Rezeption ihrer Werke
- Vergleich ihrer Werke für Erwachsene und junge Leser*innen
Selbstverständlich sind wir auch für weitere Vorschläge offen.
Bitte schicken Sie bis 15.3.2023 ein Abstract (ca. 4000 Zeichen) mit Literaturangabe und eine kurze Biografie (ca. 1000 Zeichen) an oegkjlf@univie.ac.at.
Wir melden uns bis Ende März bei allen Einreicher*innen. Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist geplant.
CFP: Erzählen am Puls der Zeit
Zu Werk und Autorschaft Ursula Poznanskis
„Sitzen, denken, tippen“, diesen Titel würde die österreichische Bestseller Autorin Ursula Poznanski einem Buch verleihen, das Einblick in ihr Leben als Autorin gibt. Dass diese puristische Formulierung ihren äußerst ertragreichen literarischen Schaffensprozess allenfalls in humorvoller und verknappter Form abbildet, sei einmal dahingestellt. Zählt Poznanski doch zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautor*innen im deutschsprachigen Rezeptionsraum, die auch mit ihren Thrillern für Erwachsene ein großes Lesepublikum anzusprechen vermag. Dabei ist die Wienerin erst relativ spät zum Schreiben gekommen, da sie nach ihrem Studium der Japanologie, Rechtswissenschaften, Publizistik und Theaterwissenschaften und diversen Statistenrollen bei der Wiener Staatsoper zunächst etliche Jahre als Medizinjournalistin tätig war. Seit ihrem literarischen Durchbruch im Jahr 2010 mit ihrem Jugendroman Erebos, der mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, hat die Schriftstellerin jedes Jahr im Durchschnitt ein bis zwei Romane veröffentlicht, die thematisch gesehen immer am Puls der Zeit waren bzw. der Technik einen Schritt voraus zu sein schienen. Ob es sich um die Realität manipulierende Computerspiele bzw. Technologiemissbrauch (Erebos 1 und 2), um virtuelle Parallelwelten und Klimakatastrophen (Cryptos), um Drohnen (Elanus), um Chancen und Risiken der modernen Hirnforschung (Thalamus), um Macht und Manipulation nach Katastrophenszenarien (Eleria-Trilogie) oder um Verschwörungstheorien (Shelter) handelt – ihr Themenspektrum erweist sich als überaus facettenreich und ist aufgrund der Aktualität sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene gleichermaßen relevant.
Ihre sogenannten Cyberspace-Novels (vgl. Gansel 2016, S. 146), die in der Gegenwart spielen und teils fantastische, teils dystopische Elemente beinhalten, zeichnen sich u.a. durch eine spannende und Sog generierende Erzählweise, durch ein komplexes Handlungsgeschehen und eine Vielschichtigkeit des Figureninventars aus. Die Texte bieten somit ein reichhaltiges, generationenübergreifendes Identifikationspotenzial für Leserinnen und Leser, zudem erweisen sie sich aber auch als kommunikativ höchst anschlussfähig für aktuelle gesellschaftliche Diskurse.
Zielstellung des Sammelbandes
Die Beiträge des Sammelbandes, der in der Schriftenreihe Kinder- und Jugendliteratur. Themen – Ästhetik – Didaktik (hrsg. von Jan Standke) erscheinen wird, sollen einen möglichst multiperspektivischen Blick auf Autorin und Werk werfen: Willkommen sind literatur- und medienwissenschaftliche Aufsätze zu einzelnen Texten, Textgruppen und Medienadaptionen ebenso Studien aus dem Bereich der jüngeren Forschung zu Autor*innenschaft bzw. Autor*innenninszenierung wie auch literatur- und mediendidaktische Beiträge, die das Potenziale der ausgezeichneten Romane für das literarische Lernen herausstellen. Beiträge in folgenden Bereichen sind erwünscht, wobei eine Erweiterung des thematischen Spektrums möglich ist:
- Werkstattbericht (Ideen, Planung des Plots, Schreibprozess, Co-Autorschaft mit Arno Strobel etc.)
- Selbstinszenierung Poznanskis als Autorin z.B. bei Lesungen, in Podcasts, in Blogs und Interviews
- exemplarische Untersuchungen von Einzeltexten unter Berücksichtigung thematischer Aspekte (z.B. fortschrittliche Technologien, Katastrophenszenarien, Formen von Gewalt und Machtmissbrauch, Konstruktionsweise von (virtuellen) Parallelwelten, Geschlechterkonzeptionen und -verhältnisse, Generationenverhältnisse, Familienbilder, Peer-Verhältnisse, soziale Milieus, medizinisches Know-How, Thriller-Elemente etc.) sowie der Kommentierung didaktischer Potenziale und konkreter Anschlüsse für literarisches Lernen in Bezug auf verschiedene Jahrgangsstufen
- Serielles Erzählen (z.B. Eleria-Trilogie, Vanitas, Kaspary & Wenniger-Thriller, Salzburg-Thriller)
- Poznanskis Texte im Medienverbund (Audiofassungen, Buchtrailer etc.)
- Ästhetik und Funktion(en) der Textillustrationen in Poznanskis Kinder- und Bilderbüchern
- Bildungsmedien: Poznanskis Werk im Spiegel von Materialien für den Literaturunterricht
Kurze Abstracts mit bio-bibliografischer Angaben werden erbeten bis zum 16.12.2022 an Inger Lison (i.lison@tu-braunschweig.de) und Jan Standke (j.standke@tu-braunschweig.de).
Die fertiggestellten Beiträge im Umfang von 48.000 Zeichen inkl. Leerzeichen sollen bis zum 16.06.2023 vorliegen.
Dr. Inger Lison / Prof. Dr. Jan Standke
Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Literatur
Technische Universität Braunschweig
Institut für Germanistik
Bienroder Weg 80
D-38106 Braunschweig
(Quelle: H-Germanistik)
CFP: Sammelband – Antonia Michaelis’ Werk: Analysen und didaktische Perspektiven
Antonia Michaelis‘ Werke erstrecken sich von Erstlesebüchern, Bilderbüchern, Kinderromanen bis hin zur Jugend- und All-Age-Literatur. Ihre wohl bekanntesten Werke sind die „Tankstellenchips“ und „Der Märchenerzähler“, aber auch die „Amazonas-Detektive“ erfreuen sich großer Beliebtheit bei jugendlichen bzw. kindlichen RezipientInnen. Thematisiert werden in ihren Texten durchaus sozialkritische Themen, etwa der Klimawandel, benachteiligte Kinder oder sogar Gewalterfahrungen (z.B. im populären „Märchenerzähler“, dessen Fortsetzung im August 2022 bei Oetinger erschienen ist). Dies geschieht sowohl in fantastischen als auch realistischen Texten.
Die Zielsetzung des geplanten, didaktisch orientierten Sammelbandes zum erzählerischen Werk der Autorin Antonia Michaelis besteht darin, das Werk einer vielschichtigen Erzählerin in den Fokus der Literaturdidaktik zu rücken. Mit seiner enormen Bandbreite bietet Antonia Michaelis‘ Werk bislang in Literaturwissenschaft und -didaktik kaum beachtete Potenziale für literarisches Lernen, literarische Sozialisation, für themenorientierte oder motivische Zugriffe. Dabei ist hervorzuheben, dass sich der Aspekt der Leseförderung mit ihren Werken, angefangen bei der Erstleseliteratur bis hin zu den All-Age-Texten, sehr gut forcieren lässt. Dennoch bleibt die didaktische Betrachtung ihrer Texte bislang recht überschaubar. Dieses Desiderat zu schließen ist uns insofern ein Anliegen, als die Texte von Michaelis sich sowohl durch ästhetische Qualität als auch ein gesellschaftlich-politisches Engagement auszeichnen. Es wird mit dem Band angestrebt, die Vielfalt der Werke transparent zu machen und sie für den schulischen Einsatz aufzuarbeiten, indem die Einzelbeiträge neben didaktisch-methodischen Überlegungen auch konkrete Unterrichtsvorschläge offerieren. Damit intendiert der Band den unmittelbaren Einsatz in der Praxis des Literaturunterrichts aller Schulstufen.
Der Sammelband wird gefördert von der Waldemar-Bonsels-Stiftung und macht es sich, dem Ziel der Stiftung entsprechend, zur erklärten Aufgabe, vielschichtige Perspektiven für die Leseförderung in unterschiedlichen Altersklassen zu entwickeln. Auch serielle Formate im Werk von Michaelis (z.B. „Kreuzberg 007“ oder „Die Amazonas-Detektive“) werden in den Blick genommen.
Darüber hinaus prägen interkulturelle und intertextuelle Wechselphänomene das Werk von Michaelis und bieten damit Möglichkeiten eines kulturvermittelnden und kultursensiblen Literaturunterrichts.
Mögliche Themen für Beiträge sind:
- Erstlesebücher von Michaelis im Anfangsunterricht
- Michaelis‘ Bilderbücher in literatur- und sprachdidaktischer Perspektive für die Grundschule
- Einzelanalysen ausgewählter Texte und/oder Serien mit didaktischen Überlegungen und methodischen Konkretisierungen (z.B. „Jenseits der Finsterbachbrücke“, „Der Märchenerzähler“, „Tankstellenchips“, „Hexenlied“, „Solange die Nachtigall singt“ u.v.a.)
- Klima- und Umweltschutz als Thema bei Antonia Michaelis (z.B. in Bezug auf „Minik- Aufbruch ins weite Meer“, „Die Amazonas-Detektive“, „Manchmal muss man Pferde stehlen“)
- Intertextualität im Werk von Antonia Michaelis
- Kindliche oder jugendliche Rezeptionen von ausgewählten Texten von Michaelis
- Gewaltdarstellungen in jugendliterarischen Texten von Michaelis (z.B. in den „Märchenerzähler“-Bänden, „Die Attentäter“ oder „Niemand liebt November“)
- Weitere eigene Vorschläge sind herzlich willkommen!
Der Band wird als print und eBook in der Reihe „Literatur – Medien – Didaktik“ im Verlag Frank & Timme bis Ende 2023 erscheinen. Abgabe der Beiträge (Umfang: maximal 40.000 Zeichen) bis 1.07.2023.
Wenn Sie Interesse haben, senden Sie bitte bis zum 12.12.2022 einen Beitragsvorschlag (max. 1 Seite) mit bio-bibliographischen Angaben an die Herausgeber*innen:
Dr. Kirsten Kumschlies: kumschlies@uni-trier.de und
PD Dr. Sebastian Bernhardt: Sebastian.bernhardt@ph-gmuend.de
Die Herausgeber*innen freuen sich auf zahlreiche Vorschläge und danken der Waldemar Bonsels-Stiftung für die großzügige Unterstützung des Vorhabens.
(Quelle: H-Germanistik, CfP)
CFP: „Schreiben!“. Autorschaft, Schreibpraxen und -formate im Feld der Kinder- und Jugendmedien, Königswinter
Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) e.V. vom 8. bis 10. Juni 2023 im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK)
Der Blick auf das Schreiben ist nicht zuletzt mit Carolin Amlingers viel beachteter Studie „Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit“ (2021) – sowie jüngst mit Steffen Martus‘ und Carlos Spoerhases Band „Geistesarbeit“ (2022) – wieder stark in die Aufmerksamkeit des öffentlichen Diskurses gerückt. Amlinger analysiert die Paradoxien des Literaturmarkts, dessen Struktur sich auf den ersten Blick seit Pierre Bourdieus „Die Regeln der Kunst“ (1992) nur wenig verändert zu haben scheint. Prototypisch fasst etwa eine Rezension in der Zeit die immer noch wirkmächtigen Diskurse ums Schreiben zusammen: „Man schreibt für die Ewigkeit und nicht für ein Massenpublikum“.
Bei näherer Betrachtung aber haben gesellschaftliche, ökonomische und technologische Entwicklungen die Literaturbranche grundlegend verändert. Autor*innen inszenieren sich z. B. systematisch über soziale Medien und werden auf diese Art öffentlich so sichtbar wie nie, und sie stehen für Marketing wie werkpolitische Deutungsstrategien als öffentliche Personen ein. Digitalisierung und insbesondere Self-Publishing bieten neue Möglichkeiten zur Veröffentlichung – und Aktivist*innen kämpfen für mehr Diversität auch in der Literatur und im literarischen Feld. Transmediale und global agierende Medienunternehmen stellen bisherige Definitionen von Autorschaft in Frage, aber auch kleinere crossmediale Projekte entwickeln neue Konzepte eines multimodalen und kooperativen Schreibens. Und in der Figur des Prosumers löst sich die grundlegende (hochkulturelle) Trennung von Autor*in und Leser*in auf.
Die Kinder- und Jugendliteratur ist Teil dieser Veränderungen und zugleich schon immer ein Feld, das germanistische Konzepte von literarischem Wert, von „l’art pour l’art“ und Autorschaft vor besondere Herausforderungen stellt. Serielle Erzählungen entstehen aus der Arbeit von Autorenkollektiven, im Bilderbuch verwischt die Grenze zwischen Autor:innen und Illustrator*innen. Die unter Erwachsenen geführte literarische Kommunikation öffnet sich, wenn junge Menschen auf YouTube, Bookstagram und TikTok zu Kritiker*innen werden und damit auch die Vorherrschaft erwachsener Literaturkritik und Gatekeeper*innen unterlaufen. Und nicht zuletzt schreiben und publizieren Kinder und Jugendliche auf digitalen Plattformen selbst.
Die Tagung will sich dem Schreiben im umfassenden Sinne also sowohl aus literatursoziologischer als auch aus buchwissenschaftlicher, aus germanistisch-begrifflicher wie kulturwissenschaftlicher Perspektive nähern. Ebenso soll die literaturwissenschaftliche Schreibprozessforschung Eingang in die Diskussionen um Kinder- und Jugendmedien finden. Dabei sollen auch die Texte und Medien selbst diskutiert werden: Schreiben und Autorschaft sind Themen und Motive in Kinder- und Jugendliteratur und -medien, sind auch struktur- und gattungsbildend, wenn man an den Tagebuchroman, an den Briefroman und seine Aktualisierungen durch Formen digitalen/sozialen Schreibens denkt.
Mögliche Themen – immer mit Bezug auf aktuelle und historische Kinder- und Jugendmedien – sind:
- Autorschaftskonzepte und (mediale) Inszenierung von Autorschaft, Autorschaftspositionierungen (Auto-Biographie, Autofiktion, Biopics)
- Poetologie und Stil
- Literaturkritik und Wertungsdiskurse
- Gattungsfragen (Tagebuch-, Brief- oder Instagramroman)
- Schreiben als kinder- und jugendkulturelle Praxis
- Schreibszenen in Kinder- und Jugendmedien (Motive, Figuren)
- Schreibräume, Schreibinstrumente, Schreiben im Digitalen: Twitterlyrik, Fanfiction, kollaboratives Schreiben, Selfpublishing, neue Formen der Literaturkritik etc.
- Schrift als Bild; Materialität und Medialität des Schreibens
Es wird auf Ihr reges Interesse gehofft und um Zusendung von Vortragsangeboten (von maximal 30 Minuten Dauer) bis zum 08.01.2023 gebeten. Ihrem Vorschlag sollte ein kurzer Aufriss des Vortragsthemas beigefügt sein.
Bitte beachten Sie bei der Einreichung Ihrer Abstracts (von ca. 300 Wörtern) folgende Anforderungen:
Die Abstracts sollen in einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur und ggf. Primärquellen nennen, auf die sich der Vortrag stützt. Damit die Vorträge zu einem Programm im oben beschriebenen Sinn zusammengestellt werden können, sollte sich der geplante Vortrag einem der oben aufgelisteten Schwerpunkte zuordnen lassen.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge per E-Mail an: u.dettmar@em.uni-frankfurt.de
(Quelle: H-Germanistik, CfP)
CFP for Edited Volume: Multidisciplinary Entanglements in Children’s Cultures and Pedagogies in the Anthropocene
This CFP has been inspired by multidisciplinary discussions about research theory and practice at the international conference Assembling Common Worlds, on the environment and young people’s literature and culture, in June 2022. As these exchanges among colleagues representing, among others, literary and cultural studies, early childhood education, and environmental humanities, have substantially expanded our thinking about different disciplinary approaches to expressions and experiences of children’s cultures during the Anthropocene, we would like to invite other scholars to join us by contributing to the edited volume we propose below.
We are interested in ways we might think about naturecultures (Haraway 2003) with children to disrupt anthropocentrism. We recognize that in all the activities and thinking we are describing below, adults and young people may be equally engaged or implicated. Barad (2011) and Haraway (2012) talk about response-ability, that is both taking care of and being responsive to the more-than-human world; we think it urgent to explore how we all can be response-able in our work with children and their cultures in times of climate change emergency, massive loss of biodiversity, and growing toxification of the planet.
Possible contributions to Multidisciplinary Entanglements in Children’s Cultures and Pedagogies in the Anthropocene may address the following questions:
- Are animals or plants ever not instrumental in human identity formation/development in pedagogic activities and/or children’s cultures?
- How are more-than-human teachers engaged and treated in pedagogy and/or children’s cultures?
- How is making kin with more-than-humans recognized, embraced, and nurtured?
- How are Indigenous epistemologies about our relations with land/water/animal and plant kin taught or expressed in/with children’s culture?
- How do children creatively respond to the current environmental crisis?
- What kinds of intergenerational creative and/or cultural projects address environmental issues?
- How might Gary Nabhan’s concept of regeneration rooted in re-story-ation (Nabhan 1991; Kimmerer 2013), listening to the stories of the land to re-learn connections between humans and nature, work in pedagogical practices or be expressed in literature and media for young people?
- How does the positioning of children and adults in relation to each other during environmental crisis reveal intergenerational (in)justices?
- Is hope a realistic or generative response to environmental crisis? How does it function?
The deadline for expressions of interest (an abstract of 300 words and a short biography) is November 30, 2022. Authors will be notified of preliminary acceptance by January 30, 2023. Full chapters (4000-6000 words) will be required by May 30, 2023. The essays should be original works not previously published and not under consideration for another publication. The commissioning editor for of a major academic press has expressed interest in this project.
Please submit proposals to:
Justyna Deszcz-Tryhubczak: justyna.deszcz-tryhubczak@uwr.edu.pl
Terri Doughty: terri.doughty@viu.ca
Janet Grafton: janet.grafton@viu.ca
(Quelle: Aussendung)
CfP: Handbuch der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur
Theorie – Themen – Didaktik
Hrsg. v. Jana Mikota & Carmen Sippl
Das Handbuch möchte sich umfassend der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur nähern, den Blick jedoch weiten und ökologische Kinder- und Jugendliteratur nicht nur als Literatur der Aufklärung und Belehrung betrachten, sondern als Literatur der literarästhetischen Sensibilisierung. Der Schwerpunkt der in den Artikeln zu behandelnden Narrative liegt nicht auf dem Sachbuch, sondern auf der erzählenden Literatur vom Bilderbuch, bis hin zum Jugendroman, auf Lyrik und Drama. Neben den theoretischen Grundlagen zu Ökologie, Kultur, Kultureller Nachhaltigkeit/CultureNature Literacy, Literaturdidaktik, Kulturökologie, Environmental Humanities stehen ökologische Narrative im Fokus.
Dazu gehören z.B.:
Atmosphäre/Stimmung, Bach/Fluss/See, Gewitter/Blitz & Donner, Energie, Grenze, Haus, Himmelsrichtungen, Insel, Jahreszeiten, Kreislauf des Lebens, Landwirtschaft/Ernährung, Luft, Nordsee, Ostsee, Ozean/Meer, Pflanzen, Quelle, Regen, Schnee & Eis, Sonne, Stein/Gestein, Strand, Technologie, Tiere, Wasser, Watt, Weltraum, Wildnis, Wolken, Zivilisation, Zone
Erwünscht sind in diesem Zusammenhang sowohl literatur- und kulturtheoretisch sowie literaturdidaktisch informierte Analysen zu diesen und anderen ökologischen Narrativen an ca. drei ausgewählten kinder- bzw. jugendliterarischen Beispielen in deutscher Sprache (original und/oder Übersetzung).
Kurze Abstracts (max. 1.500 Zeichen) sowie bio-bibliografische Angaben (ca. 150 Zeichen) werden erbeten bis zum 1.11.2022 an Carmen Sippl (carmen.sippl@ph-noe.ac.at) und Jana Mikota (mikota@germanistik.uni-siegen.de).
Die Rückmeldung erfolgt bis Ende Dezember 2022. Die fertiggestellten Beiträge sollten den Umfang von ca. 30.000 Zeichen inkl. Leerzeichen, exkl. Literaturangaben nicht überschreiten und sind bis 1. Oktober 2023 einzureichen.
Die Beiträge werden einem non-blind peer review durch die Autor*innen und die Herausgeber*innen unterzogen.
Das Handbuch erscheint 2024 in der Reihe „Pädagogik für Niederösterreich“ im Studienverlag (print und open access).
(Quelle: Aussendung)
CfP für eine Ausgabe der Zeitschrift Cultural Express
Gewalt in fiktionalen semiotischen Objekten, die für Kinder und Jugendliche bestimmt sind.
Die Gewalt, die "achte Todsünde", tendiert dazu, zu einer Konstante im zeitgenössischen Romanschreiben zu werden. Nach den Volksmärchen, in denen schamlos gefressen, getötet und verstümmelt wird, in denen es um Inzest, Misshandlung, Ausgrenzung und Unterwerfung, Aussetzung von Kindern, Kindermord, Menschenopfer, Kannibalismus geht, stellen zeitgenössische Erzählungen Gräueltaten und ihre Erscheinungsformen dar. Unter
Es werden Vorschläge für eine Analyse sowohl der Gewalttypologie in fiktionalen semiotischen Objekten für Kinder und Jugendliche als auch eine Herausarbeitung der Motive für die Handlungen, der Umstände, der Folgen und der Bedeutungen, die sich daraus ergeben erwarten. Unter Berücksichtigung der Gewaltsequenzen in der Gesamtökonomie des Werks geht es nicht nur darum, Elemente zum Verständnis der uns interessierenden Problematik beizusteuern, sondern auch die Fiktionalisierung von gewalttätigen Elementen und Situationen, die Umwelt als Produzent von Gewalt(en) zu analysieren, die sprachlichen Besonderheiten, die von den ausgewählten Autoren gewählten stilistischen und narrativen Konfigurationen, die Kunst der Charakterisierung der Figuren (Täter und/oder Opfer), die Wege des Verzichts/der Flucht aus der Gewalt zu untersuchen und die daraus zu ziehenden Lehren herauszuarbeiten. Die Hauptachsen und Fragestellungen, die in dieser Ausgabe untersucht werden können sind u.a. folgende:
- Gewalt gegen sich selbst (Selbstverstümmelung/Skarifizierung, Anorexie/Bulimie, Alkoholismus, Drogen, ...)
- Gewalt in Beziehungen (gewalttätige/zerstörerische Leidenschaften, toxische Liebe, ...)
- Sexuelle Gewalt (Vergewaltigung, Missbrauch, Prostitution, ...)
- Familiäre Gewalt, erzieherische Gewalt (Prügel, Ohrfeigen, Entbehrungen, Schikanen, ...)
- Gewalt in der Schule (körperliche/moralische Belästigung, gewöhnliche verbale/physische Gewalt, ...)
- Gewalt im Internet und in sozialen Netzwerken.
- Politische/polizeiliche Gewalt/Terrorismus/Krieg
- Gewalt in der Natur/ Gewalt gegen die Natur, Gewalt und Umwelt/ Gewalt und sozialer Raum/ Orte der Gewalt.
Die Papers (auf Deutsch, Französisch oder Englisch) werden sich mit fiktionalen semiotischen Objekten für Kinder und Jugendliche befassen, d. h. mit Romanen, Märchen, Alben, Comics, Mangas, Filmen, Videospielen, Liedern, usw. Erwartet werden innovative, originelle und natürlich unveröffentlichte Vorschläge. Doktoranden werden dazu ermutigt, einen Vorschlag für einen Artikel einzureichen.
Modalitäten und Zeitplan
Die Vorschläge (gewählter Schwerpunkt1-8, Titel, Zusammenfassung von maximal 2000 Zeichen, Schlüsselwörter, bibliografische Referenzen), sowie eine kurze Biobibliografie und die wichtigsten aktuellen Veröffentlichungen sind vor dem 01.10.2022 an die beiden nachstehenden E-Mail-Adressen zu senden: r.atzenhoffer@unistra.fr und cultx.revue@gmail.com
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung)
CfP: Harry Potters Storyworld in Theorien und Methoden der Gegenwart Einführung in die Kinder- und Jugendmedien
Lesen – Verstehen – Interpretieren stellen anthropologische Grundkonstanten dar. Wir deuten Äußerungen und Handlungen Anderer, bemühen uns, Bedeutungen zu bestimmen und versuchen, Zeichen und Vorgänge zu verstehen. Angesichts dieser Relevanz des Interpretierens auch in alltäglichen Zusammenhängen erstaunt es nicht, dass interpretatorische Prozesse in vielen Wissenschaften – auch über Literatur- und Kulturwissenschaft hinaus – eine zentrale Größe darstellen. So konstatieren Oliver Jahraus und Stefan Neuhaus in ihren Standardwerken zur Literaturtheorie (u.a. 2012; 2016), dass Medientexte nicht nur interpretationsfähig, sondern vor allem interpretationsbedürftig sind (vgl. Jahraus/Neuhaus 2012: 23). Sie plädieren in diesem Zusammenhang für Modellanalysen anhand eines literarischen Textes, um zuweilen trockene Theorie in spannende Praxis zu überführen, denn „Literaturtheorie nimmt im schulischen und universitären Bereich einen immer größeren Raum ein.“ (Jahraus/Neuhaus 2012) Ein Desiderat stellen in diesem Zusammenhang die Kinder- und Jugendmedien dar und dies, obwohl sie gerade für das Lehramtsstudium eine zentrale Bezugsgröße bilden. Dieses Desiderat will der geplante Band adressieren und die Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft um einen Methodenband bereichern, der Fokus auf methodische Zugänge des 21. Jahrhunderts legt.
Mit Blick auf das 21. Jahrhundert zeigt sich, dass kein homogenes Vorgehen in Theorie und Methodik vorherrscht. Nicht zuletzt auch, weil in die Literaturtheorien zunehmend andere Bereiche und Disziplinen wie Kulturwissenschaften, Kommunikationsforschung und Medienwissenschaften etc. einfließen. Diesem Methoden- und Theoriepluralismus trägt der geplante Band Rechnung, indem aktuelle literatur-, kultur- und medienwissenschaftlichen Tendenzen sowie Methoden und Theorien, die im und für das 21. Jahrhunderts von besonderer (auch gesellschaftlicher und sozialer) Relevanz sind, vorgestellt, diskutiert und an einer der bekanntesten und zugleich exemplarischen Storyworld der Kinder- und Jugendmedien, der von Harry Potter, erprobt werden. Auch nach 20 Jahren nimmt die Faszination nicht ab: neben der Buch- und Filmreihe ist ein ganzes Potter-Universum entstanden, dessen Figuren und Storylines ebenso wie die Rezeptionen und die Autorin selbst immer wieder auch Gegenstand kritischer Diskussionen wird.
Doch soll im geplanten Band nicht (nur) die Harry-Potter-Storyworld im Vordergrund stehen, sondern vorrangig Zugänge zu dieser Welt, die unterschiedliche Perspektiven auf die Storyworld und ihre Figuren, ihre Räume und Diskurse werfen, diese analysieren und unterschiedliche Lesarten anbieten.
Beiträge können sich der Harry-Potter-Storyworld daher u.a. aus folgenden Perspektiven nähern:
- Neo-Hermeneutik
- Poststrukturalismus
- Diskursanalyse
- Dekonstruktion
- Intertextualität
- Literatursoziologie
- Ecocriticism
- Human Animal Studies
- Visual/Media Studies (Intermedialität & Transmedialität)
- Präsenztheorie
- ANT/Netzwerktheorie
- Kognitionswissenschaftliche Ansätze
- Digital Humanities
- Intersektionalität
- Gender Studies
- Queertheorie
- Disability Studies
- Postkoloniale Literaturtheorie
- Interkulturelle Literaturwissenschaft, Transkulturelle Literaturwissenschaft,
- …
Die Publikation bildet den dritten Band der UTB-Reihe Einführung in die Kinder- und Jugendmedien. Sie stellt den Abschluss der geplanten Einführung dar, knüpft an und vertieft theoretische Inhalte der vorangegangenen Bände Grundlagen (Bd. 1) und Didaktik (Bd. 2). Die Reihe versteht sich als Einführungswerk in die Theorie, Methoden und Didaktik der Kinder- und Jugendmedien und wird herausgegeben von Stefanie Jakobi, Tobias Kurwinkel, Nicole Masanek, Michael Ritter, Philipp Schmerheim und Franziska Thiel. Die Einführung adressiert insbesondere Studierende der Germanistik bzw. des Lehramts, soll aber auch interessierten Kolleg*innen aus der Wissenschaft und unterschiedlichen Berufspraxen einen übersichtlichen Einblick in das Feld der KJM bieten.
Abstracts (max. 350 Wörter) werden bis zum 30.09.2022 erbeten. Richten Sie Ihre Beitragsvorschläge bitte mit Kurzbiografie gleichzeitig an Stefanie Jakobi (jakobist@uni-bremen.de) und Franziska Thiel (franziska.thiel@uni-hamburg.de). Für Fragen stehen die beiden Ihnen gerne zur Verfügung.
Gesucht werden wissenschaftliche Beiträge, die sich der Harry-Potter-Storyworld aus verschiedenen Perspektiven annähern. Gewünscht sind Beiträge in Erstveröffentlichung und in einem Umfang von max. 40.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen und Fußnoten), die in einem gängigen Textformat, vorzugsweise in WORD, geschrieben sind. Die Beiträge sollten zudem jeweils Vorschläge für die Marginaliengestaltung enthalten.
Die Bände erscheinen in den Jahren 2023 und 2024 innerhalb der Buchreihe utb bei Narr Francke Attempto.
(Quelle: Aussendung)
CfP: Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung 2023
Thema: Genre(s)
Krimi, Fantasy, Coming of Age, Science Fiction, Abenteuer, Road Movie, Horror, Western,
Romantic Comedy: Genres scheinen auf den ersten Blick einfach zu handhabende Kategorien
zu sein, die sich durch feste Bausteine, wie etwa ein Figurenpersonal, auszeichnen. Zum
Krimi gehören Mörder:innen und Detektiv:innen, Drachen gibt es in der Fantasy, Aliens
wiederum in der Science Fiction, während Monster in der Horror–Schublade zu finden und
Cowboys/–girls im Western zuhause sind. Gerade in der Kinder– und Jugendliteratur spielen
solche Genrezuordnungen sowohl in der Produktion als auch der Rezeption eine zentrale
Rolle. So erfüllt beispielsweise bereits die Covergestaltung häufig eine Signalfunktion, um auf
ein Genre einzustimmen. Für die Verständigung unter Rezipient:innen können Genres eine
hilfreiche Kategorie sein, wenn es z.B. darum geht, sich darüber zu informieren, was man
von einem Roman oder einem Comic, einem Film, einer TV–Serie oder einem Videospiel zu
erwarten hat. Solche Genreregeln beeinflussen auch die Produktionsseite, insbesondere bei
populären Unterhaltungsformaten. Wobei der Reiz von Genres gerade in der Spannung von
Wiederholung und Variation besteht, im Spiel oder dem Bruch mit Genrekonventionen und
in der damit verbundenen Reflexion, die sich darüber hinaus in Metagenres manifestieren
kann.
Genres organisieren die Welt des literarischen und filmischen Erzählens, aber auch die
Rezeption. Genres setzen Medien (auch historisch) in ein Verhältnis zueinander, ebenso zur
Erfahrung der Rezipient:innen mit ihnen und ihrem Wissen. Dabei lassen sie sich zwar
klassifizieren, jedoch erlaubt eine solche Taxonomie gerade nicht, die spezifische
Atmosphäre, die generische Formate ausmacht, einzufangen. Genres, so könnte man
festhalten, sind immer als hybrid und prozesshaft zu begreifen. Die Untersuchung des
Zusammenspiels generischer Modi erlaubt zudem eine tiefere Einsicht in die Poetik von
Romanen, Comics, Filmen, TV–Serien etc. Und sie bietet einen kulturanalytischen
Ansatzpunkt: „Genre analysis tells us not just about kinds of film, but about the cultural work
of producing and knowing them.“ (Gledhill 2000, 222) Fragen, die Genrepoetiken,
wiederkehrende ästhetische Figurationen, Hybridisierungsphänomene und deren Zirkulation
in historischer und inter– bzw. transmedialer Perspektive betreffen, stehen daher im
Mittelpunkt unseres Interesses.
Die neue Ausgabe des Jahrbuchs setzt an diesem letzten Punkt an, um Beiträge zu
versammeln, die Genretheorien für die Kinder– und Jugendliteratur– und –medienforschung
weiter– und neudenken. Es soll hierbei weniger um traditionelle Genrediskussionen gehen,
die sich entlang inhaltlicher Bausteine orientieren, sondern es sollen vielmehr die
Ausdifferenzierung und Hybridisierung von Genres reflektiert werden. Zunehmend entziehen
sich Neuerscheinungen im kinder– und jugendliterarischen Bereich einer eindeutigen
Zuordnung zu einem Genre. Zu fragen ist daher, wie dennoch mit einem Genrebegriff
operiert werden kann oder inwiefern dieser modifiziert werden muss. Der siebte Jahrgang
des open–access, peer–reviewed Jahrbuchs der Gesellschaft für Kinder– und
Jugendliteraturforschung widmet sich gegenwärtigen wie historischen Dimensionen von
Genre(s) in Kinder– und Jugendliteratur und –medien, insbesondere poetologischen und
ästhetischen Aspekten des Zusammenspiels generischer Modi.
Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen dieses komplexen Themas sowohl aus
theoretischer als auch aus gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen
erzählerischen und medialen Realisierungen (Romane, Kurzprosa, Lyrik, Theaterstücke,
Bilderbücher, Sachbücher, Comics, Graphic Novels, Hörmedien, Filme, TV–Serien,
Computerspiele) aufgreifen.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder– und
Jugendliteratur bzw. –medien, wären:
• Genretheorie und KJM
• Genrehybridität in der KJL (auch in historischer Perspektive)
• Genre und Gender
• Genre und Intersektionalität
• Genre und Serialität
• Genre und Inter–/Transmedialität
• Genre und Affekt
• Genre und Wissen
• Generische (Bild)Sprachen
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder– und
jugendliterarischen bzw. –medialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer
Perspektive erwünscht; auch dazu bitten wir um entsprechende Vorschläge.
Formalia:
Die GKJF hofft auf große Resonanz und bittet bei Interesse um die Zusendung von
entsprechenden Angeboten für themenbezogene bzw. offene Beiträge in Form eines
Exposés (von nicht mehr als 300 Worten) bis zum 15.09.2022. Die Exposés sollten außer
einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung enthalten, den
Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie Literatur nennen, auf die sich der Beitrag
stützt. Benachrichtigungen über die Annahme des Vorschlags und die Einladung zur
Einreichung eines Beitrags werden zusammen mit dem Style Sheet bis zum 31.10.2022
verschickt.
Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (inkl. Fußnoten und
Literaturverzeichnis) nicht überschreiten und den Herausgeberinnen spätestens bis zum
01.03.2023 als Word–Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an:
jahrbuch@gkjf.de
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder– und Jugendliteraturforschung | GKJF 2023 wird im
Dezember 2023 online veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Homepage GKJF)
CfP zur Herbsttagung der ÖG-KJLF
Show me the World – Sachbücher in und aus Österreich
Termin: 21. Oktober 2022
Ort: Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum Wien, Vogelsanggasse 36, A-1050 Wien
CfP
Das Sachbuch hat nicht nur eine lange Geschichte, sondern liegt auch in unterschiedlichsten Ausprägungen vor. Trotz des Internets, das in der (schnellen und demokratischen) Wissensvermittlung dem ‚klassischen‘ Buch zunehmend Konkurrenz macht, werden Sachbücher nach wie vor in großer Fülle produziert und nachweislich von (erwachsenen) Käufer*innen und Schenkenden und von jungen Leser*innen auch rege rezipiert.
Mit dieser Tagung möchten wir einen Blick auf die historische Entwicklung dieser proteischen Gattung werfen, zugleich aber auch aktuelle Entwicklungen vorstellen und virulente Problemlagen thematisieren. Denn die Welt zu erklären bedeutet auch immer einen gewissen Blickpunkt einzunehmen und einen Standpunkt zu vertreten. So ist das Sachbuch trotz aller Sachlichkeit nie wertfrei zu sehen, sondern birgt in sich stets Ansichten und Wertvorstellungen. Auch die Frage, was im Sachbuch gezeigt wird, ist nicht neutral, ebenso wenig die Bezeichnungen von Menschen oder Tieren, die Bilder von fremden Kulturen oder geografische Benennungen. Der schmale Grat zwischen Subjektivität und generischer Objektivität ist somit durchgehend im Fokus zu behalten, um die entsprechenden Publikationen korrekt einordnen zu können.
Wir laden Sie ein, ein Abstract (ca. 500 Wörter) und eine kurze Biografie (ca. 300 Wörter) auf Deutsch oder Englisch bis zum 15.08.2022 an oegkjlf@univie.ac.at einzureichen.
Mögliche Themen sind beispielsweise:
- die Entwicklung des Sachbuchs für Kinder und/oder Jugendliche speziell in Österreich
- Vergleiche von Sachbüchern Deutschland/Österreich/Schweiz (und darüber hinaus)
- neue Formen der Sachbücher (und der Vgl. mit anderen Medien)
- die Bedeutung des Sachbuches im Zeitalter des globalen Wissenszugangs
- Sachbuchautor*innen im Blick
- Rassismus/Vorurteile/Rollenzuschreibungen im Sachbuch ...
CfP: TENTH ANNIVERSARY ISSUE
Children’s Literature in English Language Education
Submissions are invited for our tenth anniversary issue which will be published in November 2022 on the following theme:
Exploring the affordances of children’s literature in ELT on any of these topics:
• interculturality and ideology
• intercultural citizenship education
• interculturality in teacher education
• interculturality in materials design
For submission details, please see the Information for authors and the Style guide
To submit a paper, please visit here
Papers (Word files) can also be sent as email attachments to: clelejournal@nord.no
The deadline for submissions for the anniversary issue is 1 July 2022
Editor-in-chief: Janice Bland • Reviews editor: David Valente • Associate editor: Susanne Reichl
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Kinder- und Jugendliteratur in der DDR
Termin: 08. bis 10. September 2022
Ort: Universität Potsdam/Universität Stettin
CfP
Der Ansatz der Tagung lässt sich so beschreiben: Es geht explizit nicht darum, die KJL in der DDR an einem Moderne-Begriff zu messen, der westlichen Gesellschaften abgezogen ist, sondern darum das, was man Ost-Moderne und in Folge Post-Ost-Moderne nennen kann (Pabst 2016) ernst zu nehmen. Dies bedeutet, dass die Ost-Moderne und die in dem gesellschaftlichen Gefüge entstehende Literatur an den systemeigenen Regularitäten gemessen wird. Damit ist auch die jeweilige „gesellschaftliche Funktion“ von Literatur in den einzelnen Phasen mitzudenken und zu fragen, inwieweit der konkrete Text den aktuellen „Vereinbarungen“ entspricht oder aber möglicherweise eine Art „Vorgriff“ darstellt, der irritierend bzw. als Aufstörung wirken kann (Gansel 2016).
Die Beiträge können entsprechend auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet sein:
- Darstellungen zu einzelnen Entwicklungsetappen in Verbindung mit dem jeweiligen Stand der Ost-Moderne;
- Einzelanalysen ausgewählter Texte als Reflex auf gesellschaftliche Modernisierungsphänomene in der DDR;
- Untersuchungen zur Rolle phantastischer Präsentationsarten und zu Adaptionen mythischer Stoffe;
- Beiträge zur KJL in der DDR, die zeigen, warum einzelne Texte in den Status einer „Aufstörung“ gerieten.
In einem zweiten Teil der Tagung soll es um Texte der Post-DDR-Literatur gehen. Dabei interessiert vor allem die Frage, in welcher Weise DDR-Kindheit und -Jugend nach 1989 erinnert werden. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, inwieweit Texte dem entsprechen, was der Historiker Martin Sabrow seit der Wende zum 21. Jahrhundert herausgestellt hat, dass nämlich im „öffentlichen Umgang mit der DDR“ die „klaren Schwarz-Weiß-Linien des Diktaturgedächtnisses“ dominieren, „das den „Unterdrückungscharakter der SED-Herrschaft und ihre mutige Überwindung in der friedlich gebliebenen Revolution von 1989/90“ (Sabrow 2010) betonen. Neueste Untersuchungen suchen zu zeigen, welche Folgen sich aus derartigen Schemata ergeben können (Gansel/Fernandez-Perez 2022, Fernandez-Perez 2022).
Die genannten Aspekte verstehen sich als Rahmen für Beitragsvorschläge. Weitere Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. Die Veranstalter erbitten ein kurzes Abstract und Informationen zum CV (ca. 15 Zeilen) bis zum 20. Juni 2022 an folgende Anschriften:
Prof. Dr. Carsten Gansel (carsten.gansel@germanistik.uni-giessen.de)
Dr. José Fernández Pérez (Jose.Fernandez-Perez@germanistik.uni-giessen.de)
Sekretariat: Katja Wenderoth (Katja.Wenderoth@germanistik.uni-giessen.de)
Organisation/Leitung: Prof. Dr. Carsten Gansel, Dr. Monika Hernik, M.A. Anna Kaufmann.
(Quelle: H-Germanistik - H-Net)
CfP Sammelband: Idyllen und Sehnsuchtsorte in der Kinder- und Jugendliteratur und in Kinder- und Jugendmedien
Fachwissenschaftliche Analysen und fachdidaktische Modellierungen
Der geplante Sammelband erscheint in der von Prof. Dr. Jan Standke herausgegebenen Schriftenreihe „Kinder- und Jugendliteratur. Themen – Ästhetik – Didaktik“ und möchte im Anschluss an den literaturwissenschaftlichen Idyllen-Diskurs der Gegenwart (einschließlich der Kinder- und Jugendliteraturforschung) Idyllen und Sehnsuchtsorte bzw. das Idyllische sowohl gegenstandsorientiert-analytisch als auch didaktisch-modellierend in den Blick nehmen.
Das von der Waldemar-Bonsels-Stiftung geförderte Vorhaben wird im Rahmen einer Kooperation zweier Universitäten umgesetzt und berücksichtigt das Werk Waldemar Bonsels (insbesondere Die Biene Maja) in gebührender Weise.
Willkommen sind Beiträge, die folgenden Anregungen nachgehen:
- Berücksichtigung des ‚Aus-der-Zeit-Fallens‘ in Anknüpfung an Bachtins Lehre vom Chronotopos (vgl. Bachtin 1973)
- Aufgreifen der Dynamisierungs- und Subjektivierungstendenzen der Gegenwart (z.B. heterogene Auffassungen von Idylle und individualisierte Klassifizierungen als Philotop)
- Berücksichtigung des modernen Verhältnisses Mensch-Umwelt bzw. Natur-Kultur sowie ggf. aktueller Ansätze des Ecocriticism (vgl. Schmitt 2022, Zemanek 2015, Wanning/Stemmann 2015, Standke 2019, Standke/Wrobel 2021 sowie das kommende GKJF-Jahrbuch 2022 „Natur schreiben“ und die Forschergruppe rund um „Climate Thinking“)
- Modellierungen für die ästhetischen Fächer (Musik, Kunst, Theater) in einer Fächerverbindung mit dem Literaturunterricht/Medienunterricht
Beitragsvorschläge (ca. 1 Seite, mit 3-4 Literaturangaben) zuzüglich einer Kurzvita (3-5 Zeilen) werden bis zum 1.4.2022 erbeten an:
lea.grimm@philhist.uni-augsburg.de und NilsLehnert@uni-kassel.de
Eine Tagung zum Thema des Sammelbandes ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich vom 2. bis 3. Dezember 2022 stattfinden.
(Quelle: H-Net)
CfP: Tomi Ungerer, border hopper (1931-2019) : Languages, images and childhood
International Conference: 17th and 18th november 2022
Coined by the artist himself, the term « border hopper » is undoubtedly the most apposite way of describing Tomi Ungerer, born in 1931 in Strasbourg. It also aptly qualifies one who, raised on the border between Germany and France, spoke four languages – French, English, German and of course Alsatian – and whose places of residence were Colmar, New York, and Nova Scotia before finally putting the suitcase down in Ireland, a country where he felt at home.
Until February 2019, a great many different paths marked a career that gave us works as diverse as The Three Robbers, The Party, Zeralda’s Ogre and Slow Agony. His internationally acclaimed books amount to over a hundred titles, translated in more than thirty languages. As an author and illustrator, he was awarded several major distinguished prizes. In France, the « Grand Prix des arts graphiques », in Montreal, the best cartoonist of the year award, in Germany, the « e.o. Plauen » prize, to which we need to add the prestigious Hans Christian Andersen Award, awarded by IBBY in 1998.
In view of such a multifaceted and Protean body of work, both in terms of scope and range, this conference aims to reflect those qualities and live up to the legacy of an author and illustrator who has become a classic, and whose creativity has never ceased to inspire.
The organizer wishes to honor him as a border hopper across countries, languages, narratives, fictional worlds, cultures and readerships.
They invite participants to submit papers that address the author-illustrator as a multifaceted border hopper, bearing in mind how much he inspired other artists all through his lifetime as he will doubtless do in the future.
How do Tomi Ungerer’s idiosyncratic style and spirit resonate with contemporary creators?
What source of inspiration is he for them?
What part of his work is most influential and to whom?
Papers that examine how Ungerer’s work is revisited will emphasise the energy and the visionary quality of the original material. Presentations of projects which combine research and creativity will be welcome as they reflect border hopping between academia and artistic practice. The aim is to map out influences, legacy patterns, rewritings and common imaginary worlds based on the undisputable modernity of Ungerer’s work.
Proposals may come from different academic fields, as well as from more creative disciplinary areas.
The following topics will be discussed:
1 : Tomi Ungerer, border hopper across languages and cultures
This topic will explore cross-disciplinary approaches such as languages, Ungerer’s own multilingualism, the role of translation and self-translation. Papers will address cross-cultural influences in the artist’s work (French, German, English and Alsatian), with a focus on the different types of humour they convey.
2 : Tomi Ungerer, border hopper between word and image
Contributions to this topic will engage with Ungerer’s writing, both in word and image, and explore how they interact in graphic and narrative styles. Ungerer’s sense of a narrative and his visual poetry may be discussed according to various perspectives. Intermediality, transmediality, formats, and material culture may be examined with respect to Ungerer’s own sources and with a particular interest for a tangible legacy in the younger generation of artists. Another angle for proposals could be how he influenced illustration and children’s literature.
3 : Tomi Ungerer, border hopper for children and adults alike
Contributions on this topic will engage with Ungerer’s imagined readerships. Participants can look at the portrait of the artist as a young boy during World War II and under the Nazi regime, to discuss how art allowed to overcome the trauma of those “dark monsters”. Papers on Ungerer’s reception in schools will be particularly welcome so as to shed light on how children have appropriated the author’s world, then and now. It will provide an opportunity to look at his satirical side, which subverts taboos, alongside the importance of publishing contexts (original editions, translations, new editions) that prevail in reception studies in general.
4 : Tomi Ungerer, border hopper across countries
Papers in this category will aim to contribute to widening the scope of Ungerer’s reception worldwide, with its historical depth and focus on encounter with others. The Franco-German dimension of this topic will be specially favoured. Libraries, museums, publishers have vastly helped towards the recognition and popularity of Tomi Ungerer: a study of their active part and the different forms of mediation they opted for will be welcome so as to account for the process whereby this artist’s work, for children and adults alike, has come to be part and parcel of the world’s literary and artistic heritage.
Bibliography
Bibliographical references to the body of work by Tomi Ungerer are available on the website of the CNLJ, Centre national de la littérature pour la jeunesse (The National Centre of Children’s Literature):
https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/ungerer_tomi.pdf
Individual papers should not be more than 25 minutes in length.
Working languages: French, English
A selection of papers will be reviewed for publication, which is part of the project.
Deadline for proposals:
Proposals (title, abstract of 1500 signs max) should be submitted by April 15 at the latest.
They should be sent to:
marion.caliyannis@bnf.fr and communication.iicp@club-internet.fr
(Quelle: Aussendung)
CfP und Seminar des Arbeitskreises für Jugendliteratur 2022
Thema: "Lust auf Sprache. Neue Spielräume für und mit Literatur eröffnen"
Termin: 11. bis 13. November 2022
Ort: Katholisch-Sozialen Institut, Siegburg
Denglisch, tweeten und gendern sind aktuell nur drei Beispiele, die zeigen: Sprache ist wandelbar, flexibel und verspielt. Sprache kann Zusammengehörigkeit signalisieren, Teilhabe ermöglichen, aber auch ab- und ausgrenzen.
Kinder begegnen Sprache(n) intuitiv, erobern sich mit neuen Wörtern neue Bereiche ihrer Welt. Lieder, Reime, Geschichten und natürlich auch Bücher unterstützen sie dabei, scheinbar spielerisch ihren Wortschatz zu mehren. Begleitet werden junge Wortsammler:innen von Eltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen. Diese geben entscheidende Impulse, damit Kinder Freude an Sprache entwickeln, ihre Wort-Schatztruhen füllen, Worte sinnvoll kombinieren und entsprechend in Kommunikation mit ihrer Umwelt gehen können.
Das komplexe System Sprache ist darüber hinaus ein wahres Spielfeld für die Phantasie, ihre ästhetische Dimension kommt nicht zuletzt in der Literatur zum Ausdruck. Mit diesem Seminar wollen wir die Lust am kreativen Umgang mit Sprache(n) entfachen, für ihre Schönheit sensibilisieren, Ideen für die Vermittlungspraxis entwickeln und uns bewusst machen, welche Macht wir auf der Zunge tragen.
Folgende Aspekte sollen betrachtet werden:
- Mein WortSCHATZ. Lauschen, Bewegen und (Be-)Greifen – Spielerischer Spracherwerb von Anfang an
- Erzähl mir die Geschichte vom Pferd. Mündliches Erzählen, Fabulieren, Geschichten erfinden, Vorlesen, Sprechanlässe schaffen
- Krikelkrakel und Geheimsprachen. Wenn Schrift und Sprache Hand in Hand gehen
- Wenn man in mehreren Sprachen gleichzeitig zu Hause ist. Mehrsprachigkeit als Potenzial
- Spunk, Snitch oder Satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch – Wortneuschöpfungen
als Inspirationsquelle - Es lebe die Poesie. Vom Kniereiter zum Kindergedicht zum Haiku zum Poetry Slam
- Wenn der Text zum Spielfeld wird. Freude am Unsinn, Freude am Nonsens, an Witz und
Ironie - Sheesh! Jetzt wird ́s echt wyld! Wie sich Jugendliche ihre Sprache formen und was davon Eingang in die Literatur findet
- Verdichtet oder verhunzt? Wie Soziale Medien Sprache verändern und neue Formen hervorbringen
Möglicher Abschlussbeitrag:
Für Kinder nur das Beste. Schreiben für ein junges Publikum erfordert ein besonderes Sprachbewusstsein, weil Literatur in diesem Alter besondere Wirkung hat, lange in Erinnerung bleibt und prägend ist. Autor:innen, Verlage und Vermittler:innen stehen hier in der Verantwortung
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Pädagog:innen/Lehrkräfte, Bibliothekar:innen, Buchhändler:innen, Journalist:innen, Autor:innen, Illustrator:innen, Verlagsmitarbeiter:innen sowie weitere Multiplikator:innen von Kinder- und Jugendliteratur.
Mögliche Formate:
- Hauptvortrag (45 Minuten),
- Kurzvortrag (30 Minuten),
- Arbeitsgruppe (ca. 4 Stunden),
- Podiumsdiskussion (30 Minuten / mit Vorschlägen für einzuladende Personen)
Abstracts, max. 1.500 Zeichen:
Neben einer Inhaltsskizze zu einem der oben genannten Aspekte bitten wir um einen Arbeitstitel, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund).
Einsendeschluss: ist der 15. Februar 2022 an bernd@jugendliteratur.org
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung AKJ)
CfP: Exil in Kinder- und Jugendmedien
Jahrbuch Exilforschung 2023
In der Erwachsenenliteratur des Exils, insbesondere in jüngeren Texten, wird das Exil oftmals aus der Kinderperspektive erzählt und erinnert. Während diese Texte in der Forschung aufmerksam zur Kenntnis genommen wurden und werden, blieb und bleibt die Kinder- und Jugendliteratur des Exils auffallend schwach ausgeleuchtet, einige Klassiker ausgenommen wie Judith Kerrs Als Hitler das rosa Kaninchen stahl oder Lisa Tetzners und Kurt Kläbers Die Kinder aus Nr. 67. Im Gegensatz dazu boomt die Forschung zu aktuellen kinder- und jugendliterarischen Werken, in denen Themen wie Flucht und Migration verhandelt werden; die Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung beispielsweise beleuchtete das Thema 2017 in ihrem Jahrbuch.
Vor dem Hintergrund dieser Forschungslage widmet sich das Jahrbuch Exilforschung 2023 schwerpunktmäßig Werken, die zwischen 1933 und 1945 entstanden sind und/oder Exilerfahrungen aus dieser Zeit beschreiben. Verweise und Einzeluntersuchungen sowie Bezugnahmen auf die Forschung zu anderen – auch internationalen – in Buchform gestalteten Exilerfahrungen, insbesondere im Bereich der Migrations-KJL der Gegenwart oder auch wenig beachtete Publikationen aus der Zeit des 19. Jahrhunderts sind ausdrücklich erwünscht und sollen die bisherige enge Festlegung der Exil-Kinder- und Jugendliteratur programmatisch öffnen. Das Jahrbuch widmet sich dezidiert der Kinder- und Jugendliteratur, ist dabei jedoch offen für ‚Grenzgänger‘ wie etwa Irmgard Keuns Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Zum Korpus hinzugerechnet werden kinder- und jugendliterarische Werke, die die Kindertransporte zum Thema haben.
Zudem versteht sich das Jahrbuch als interdisziplinäres Forum, soll Beiträge aus der Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Pädagogik und benachbarten Fächern versammeln. In der Kunstgeschichte ist das illustrierte Kinder- und Jugendbuch oder das Bilderbuch noch wenig erforscht. Zu den beachteten exilierten Zeichner*innen für das Kinder- und Jugendbuch zählt Walter Trier (siehe die Publikationen von Antje M. Warthorst). Zu anderen künstlerischen Autor*innen des Bilderbuchs wie der Fotografin Ylla, die nach Paris und New York emigrierte, ist kaum geforscht worden.
Mit der Fokussierung auf Kinder- und Jugendmedien verbindet sich die Absicht, stärker als sonst üblich an Kinder und Jugendliche adressierte Werke in den Blick zu nehmen, also Bilderbücher und illustrierte Bücher, Comics und graphic novels, auch Filme und Videoinstallationen. Didaktische Überlegungen sollen in allen Beiträgen zwar berücksichtigt werden, nicht aber die Überlegungen maßgeblich leiten. Im Vordergrund sollen vielmehr Analysen der Erzählverfahren und Ästhetik der (Bilder-)Bücher/Medien stehen. Es gilt, vernachlässigte oder vergessene Autor*innen und Werke neu oder aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken oder wieder an sie zu erinnern, wie etwa das Kinderbuch „Beatriz und die Platane“ der in Portugal exilierten Autorin Ilse Losa, das kürzlich auf Anregung von Irene Below und Barbara Daiber erstmals in deutscher Übersetzung erschien.
Ziel des Jahrbuchs ist es, auf das beschriebene Forschungsdesiderat in der exilliterarischen Forschung aufmerksam zu machen, Anregungen zu weiterführenden Arbeiten zu geben und Entdeckungen vorzustellen. Ziel ist es auch, eine Brücke zwischen Erwachsenen- und Kinderliteratur zu schlagen und zu zeigen, dass existentielle Grunderfahrungen wie die des Exils vielleicht in besonderer Weise dazu einladen, im Lyppschen Sinne ‚einfach‘ erzählt zu werden.
Abstracts (max. 1 DIN A 4 Seite) mit Kurzbiografie in einem pdf sind bis zum 15. März 2022 einzureichen.
Die ausgearbeiteten Beiträge (bis max. 40.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und Bibliografie) sind erwünscht bis 15. Oktober 2022.
Einreichungen sind zu richten an die Herausgeberinnen des Jahrbuchs 2023:
Prof. Bettina Bannasch (bettina.bannasch@philhist.uni-augsburg.de)
Prof. Burcu Dogramaci (burcu.dogramaci@kunstgeschichte.uni-muenchen.de)
Dr. Theresia Dingelmaier (theresia.dingelmaier@philhist.uni-augsburg.de)
(Quelle: Aussendung)
CfP und Seminar des Arbeitskreises für Jugendliteratur 2022
Thema: "Lust auf Sprache. Neue Spielräume für und mit Literatur eröffnen"
Termin: 11. bis 13. November 2022
Ort: Katholisch-Sozialen Institut, Siegburg
Denglisch, tweeten und gendern sind aktuell nur drei Beispiele, die zeigen: Sprache ist wandelbar, flexibel und verspielt. Sprache kann Zusammengehörigkeit signalisieren, Teilhabe ermöglichen, aber auch ab- und ausgrenzen.
Kinder begegnen Sprache(n) intuitiv, erobern sich mit neuen Wörtern neue Bereiche ihrer Welt. Lieder, Reime, Geschichten und natürlich auch Bücher unterstützen sie dabei, scheinbar spielerisch ihren Wortschatz zu mehren. Begleitet werden junge Wortsammler:innen von Eltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen. Diese geben entscheidende Impulse, damit Kinder Freude an Sprache entwickeln, ihre Wort-Schatztruhen füllen, Worte sinnvoll kombinieren und entsprechend in Kommunikation mit ihrer Umwelt gehen können.
Das komplexe System Sprache ist darüber hinaus ein wahres Spielfeld für die Phantasie, ihre ästhetische Dimension kommt nicht zuletzt in der Literatur zum Ausdruck. Mit diesem Seminar wollen wir die Lust am kreativen Umgang mit Sprache(n) entfachen, für ihre Schönheit sensibilisieren, Ideen für die Vermittlungspraxis entwickeln und uns bewusst machen, welche Macht wir auf der Zunge tragen.
Folgende Aspekte sollen betrachtet werden:
- Mein WortSCHATZ. Lauschen, Bewegen und (Be-)Greifen – Spielerischer Spracherwerb von Anfang an
- Erzähl mir die Geschichte vom Pferd. Mündliches Erzählen, Fabulieren, Geschichten erfinden, Vorlesen, Sprechanlässe schaffen
- Krikelkrakel und Geheimsprachen. Wenn Schrift und Sprache Hand in Hand gehen
- Wenn man in mehreren Sprachen gleichzeitig zu Hause ist. Mehrsprachigkeit als Potenzial
- Spunk, Snitch oder Satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch – Wortneuschöpfungen
als Inspirationsquelle - Es lebe die Poesie. Vom Kniereiter zum Kindergedicht zum Haiku zum Poetry Slam
- Wenn der Text zum Spielfeld wird. Freude am Unsinn, Freude am Nonsens, an Witz und
Ironie - Sheesh! Jetzt wird ́s echt wyld! Wie sich Jugendliche ihre Sprache formen und was davon Eingang in die Literatur findet
- Verdichtet oder verhunzt? Wie Soziale Medien Sprache verändern und neue Formen hervorbringen
Möglicher Abschlussbeitrag:
Für Kinder nur das Beste. Schreiben für ein junges Publikum erfordert ein besonderes Sprachbewusstsein, weil Literatur in diesem Alter besondere Wirkung hat, lange in Erinnerung bleibt und prägend ist. Autor:innen, Verlage und Vermittler:innen stehen hier in der Verantwortung
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Pädagog:innen/Lehrkräfte, Bibliothekar:innen, Buchhändler:innen, Journalist:innen, Autor:innen, Illustrator:innen, Verlagsmitarbeiter:innen sowie weitere Multiplikator:innen von Kinder- und Jugendliteratur.
Mögliche Formate:
- Hauptvortrag (45 Minuten),
- Kurzvortrag (30 Minuten),
- Arbeitsgruppe (ca. 4 Stunden),
- Podiumsdiskussion (30 Minuten / mit Vorschlägen für einzuladende Personen)
Abstracts, max. 1.500 Zeichen:
Neben einer Inhaltsskizze zu einem der oben genannten Aspekte bitten wir um einen Arbeitstitel, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund).
Einsendeschluss: ist der 15. Februar 2022 an bernd@jugendliteratur.org
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung AKJ)
CfP und Tagung: Children’s Literature Across Media: Concepts and Perspectives of Transmedia Narratives
Time: 29 September to 1 October 2022
Place: Forschungskolleg Humanwissenschaften Bad Homburg (Frankfurt), Germany
The overall ambition of the conference is to bring together an international group of researchers from media studies, children's literature studies and book studies in order to discuss the narration, production and reception of transmedial storytelling for children and young adults. Traditionally, there has been little interaction between these fields, despite the fact that they all potentially include the (co-)production and reception of texts, media and narratives for and by children across media as well as the character of these artefacts. While children have had access to and engaged in the same narratives across several media over the centuries, digitisation, mediatisation and convergence cultures have fundamentally changed the conditions of transmedia production, storytelling and reception, especially when it comes to children and young people's opportunity to participate in, interact with and produce narratives themselves.
On this background, the Editorial Team invite proposals for papers (20 minutes) that include case studies of:
- Worldbuilding and characters in children's texts and media
- Participation and co-authorship
- Transmedia products for children and young adults (for instance, literature, comic books,
- movies, series and computer games)
- The (book) market and convergence culture around children's texts and media
The Editorial Team ask for 300-word abstracts for 20-minute papers.
Please submit your abstracts and a 100-word bio-note by 1 February 2021 to Ute Dettmar (u.dettmar@em.uni-frankfurt.de) and Nina Christensen (NC@cc.au.dk).
(Quelle: Ausschreibung)
CfP: Puppen und Puppenfiguren in Narrativen
CfP Korrektur/ Fristverlängerung: Puppen und Puppenfiguren in Narrativen – historische und gegenwärtige Themen und Motive weltweit in Literatur, Theater, Film, Medien, Alltags- und Populärkulturen
Der fünfte CfP der Zeitschrift denkste: puppe / just a bit of: doll (de:do), eine multidisziplinäre Zeitschrift für Mensch-Puppen-Diskurse, verfügt als Online-Journal ab jetzt über eine eigene Plattform.
Alle Informationen rund um das Journal sowie alle bisher erschienenen Ausgaben sind frei verfügbar und abrufbar.
Themenschwerpunkt und Terminvorgaben für den fünften CfP werden aus diesem Anlass präzisiert. Unabhängig vom Schwerpunktthema können gerne auch jederzeit freie wissenschaftliche Texte sowie Miszellen und andere, auch „kleinere“ Präsentations-Formate (z.B. Interviews, Rezensionen, Essays, künstlerische Werkbeispiele etc.) zu Mensch-Puppen-Aspekten eingereicht werden. Alle Beiträge gehen durch einen internen Reviewprozess, die wissenschaftlichen Artikel unterliegen zusätzlich einem externen
Peer-Review-Verfahren.
Der aktuelle Themenschwerpunkt Puppen und Puppenfiguren in Narrativen – historische und gegenwärtige Themen und Motive weltweit in Literatur, Theater, Film, Medien, Alltags- und Populärkulturen fragt nach – im weitesten Sinne – puppenbezogenen kulturhistorischen Wurzeln, Traditionen und Varianten sowie
aktuellen Themen, Narrativen und Motiven in Literatur, Kultur, Medien und Alltagspraxen,
unabhängig von Alter und/oder Besonderheiten der Adressatengruppen.
Der Call ist „weltweit“ (international) und historisch ausgerichtet, um der Vielfalt und Vielschichtigkeit
von Puppen-Narrativen und -Motiven in ihren literarischen und kulturellen Rezeptions- und Anwendungsfeldern nachzuspüren. Das schließt die menschheitsgeschichtlich frühen Anfänge von Puppenthematiken unterschiedlichster Art mitsamt ihren universell und/oder kulturspezifisch konnotierten Traditionen, Folkloren, Spuren und Entwicklungsverläufen genauso mit ein wie die aktuelle Thematik künstlicher „Puppen“- Menschen in den unterschiedlichen literarischen, theatralen, kulturellen, aber auch informationstechnologischen Feldern. Wechselseitige interkulturelle Rezeptionsbezüge, „Übersetzungen“, Rückwirkungen und „Metamorphosen“ von Puppen-Narrativen interessieren in diesem Zusammenhang.
Nicht zuletzt ist der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur und -kultur hier ausdrücklich angesprochen.
Der Call richtet sich somit an eine Vielzahl von geistes-, sozial- und human- wissenschaftlichen Disziplinen, in deren Theorie-, Forschungs- und Praxisbezügen puppenbezogene Narrative und Themen identifizierbar sind, seien sie explizit formuliert oder aber subtil in ihrer Bedeutung und Wirksamkeit erkennbar.
Die (wissenschaftlichen) Beiträge können etwa 30.000 Zeichen umfassen. Andere Textformate sollten kürzer sein (5.000- 20.000 Zeichen).
Das angesprochene Themenspektrum ergibt sich aus den oben genannten Überlegungen. Die Texte sollen interdisziplinär verständlich sein und können auf Deutsch oder Englisch als elektronische-Datei beim Editorial Team (Prof. Dr. Insa Fooken, fooken@psychologie.uni-siegen.de und/oder Dr. Jana Mikota, mikota@germanistik.uni-siegen.de) eingereicht werden.
Skizzen für einen Beitrag (ca. 3.500 Zeichen) und eine Kurz-Vita erbitten wir ab sofort bis Mitte Januar 2022. Rückmeldungen zur Aufforderung, einen Beitrag einzureichen, erfolgen zeitnah. Die endgültigen Manuskripte sollten bis zum 15. Mai 2022 vorliegen. Der geplante Publikationstermin ist Ende des Jahres 2022.
CfP (de & en)
(Quelle: Aussendung)
CfP – Jahrestagung der GKJF 2022
Körper und Körperlichkeit in Kinder- und Jugendliteratur und -medien
34. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
Termin: 26. bis 28. Mai 2022
Ort: Stephanisaal/Stephansplatz (Donnerstag), Stephansplatz 3,1010 Wien; Kardinal König Haus (Freitag und Samstag), Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien
CfP
Die 34. Tagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) setzt sich zum Ziel, der vielfältigen Inszenierung, Gestaltung und Präsentation von Körper und Körperlichkeit, die in der Kinder- und Jugendliteratur verhandelt wurden und werden, nachzuspüren.
Dabei sollen sowohl inhaltliche als auch formale Betrachtungsweisen ins Zentrum gerückt, historische und gegenwartsbezogene Perspektiven eröffnet und fiktionale und faktuale Texte und Medien behandelt werden.
Mögliche Themen – immer mit Bezug auf die Kinder- und Jugendliteraturforschung – sind:
- Körpernormen und Normalitätsvorstellungen in historischen und aktuellen Perspektiven (Bodyshaming, Bodypositivity)
- Norm und Abweichung: deformierte/behinderte Körper, gesunde/kranke Körper
- Körper und Diversity, Race, Gender, Class
- Körper und Komik: Groteske und Karnevaleske Körper,
- Politisierung, Vermarktung, Kommodifizierung und Sexualisierung des Körpers
- Körper und Migration, Religion
- Inszenierung von Körpern und Körperlichkeit in genre- und medienspezifischen
- Tote, untote und hybride Körper: Human vs. Non-Human/ Post-Human Body, Cyborgs,Körper und Ethik, Artificial Intelligence
- Kollektive Körper / metaphorische Körper
- Faktuale Körper (z. B. in Sachbüchern)
- Körperräume und Körper als Erzählräume
- Postkoloniale Perspektiven auf exotisierte Körper
- Textkörper, Hybridisierungen, Materialität, Intermedialität, Multimodalität
Die GKJF hofft auf reges Interesse und bittet um Zusendung von Vortragsangeboten (von maximal 30 Minuten Dauer) bis zum 09.01.2022.
Ihrem Vorschlag sollte ein kurzer Aufriss des Vortragsthemas beigefügt sein.
Bitte beachten Sie bei der Einreichung Ihrer Abstracts (von ca. 300 Wörtern) folgende Anforderungen:
Die Abstracts sollen in einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur und ggf. Primärquellen nennen, auf die sich der Vortrag stützt. Damit die Vorträge zu einem Programm im oben beschriebenen Sinn zusammengestellt werden können, sollte sich der geplante Vortrag einem der oben aufgelisteten Schwerpunkte zuordnen lassen.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge per E-Mail an: u.dettmar@em.uni-frankfurt.de
In Kooperation mit der STUBE – Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur, Wien
(Quelle: Aussendung GKJF)
CfP und Symposium "Abgehängt?! Bildungs- und Teilhabe-Chancen auf dem Prüfstand"
Symposium auf der Leipziger Buchmesse 2022
Termin: 19. März 2022, 10:30 bis 13:30 Uhr
Ort: Leipziger Buchmesse
CfP
In Deutschland hängt der Bildungserfolg weiterhin von der Herkunft und dem sozialen Status ab – und zwar stärker als im OECD-Durchschnitt. Kinder und Jugendliche aus so genannten Risikolagen sind dabei besonders benachteiligt und die Corona-Pandemie hat diese Ungleichheit zusätzlich verschärft. Denn Kinder und Jugendliche hatten besonders unter Kita- und Schulschließungen und fehlenden Sozialkontakten zu leiden; ihre Bedürfnisse wurden vernachlässigt, ihre Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt.
Aufholprogramme versuchen nun gegenzusteuern. Dabei reicht es jedoch nicht, Lernlücken zu schließen; es muss vielmehr darum gehen, jungen Menschen generell bestmögliche Chancen auf gute Bildung und für ihre persönliche Entfaltung zu bieten. Lesekompetenz und literarische Erfahrungen sind dafür basale Bausteine. Entsprechend will dieses Symposium ausloten, welchen Beitrag die Kinder- und Jugendliteratur und die verschiedenen Akteure der Leseförderung für mehr Bildungsgerechtigkeit leisten können. Dabei müssen gezielt die Bedürfnisse und Interessen derjenigen Kinder und Jugendlichen in den Blick genommen werden, denen Lesen schwerfällt oder die meinen, dass Bücher nichts für sie sind.
„Die Rolle von Kunst- und Kulturprogrammen für junge Menschen besteht insbesondere darin, die Armut an Vorstellungskraft zu bekämpfen, die durch herausfordernde Umstände entstehen kann.“ Yvette Hardis, ASSITEJ Südafrika
Mögliche thematische Aspekte:
Zahlen und Befunde: Inwiefern hat die Pandemie den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen verschärft? Wie verhält es sich mit der Sprachbildung und Lesefähigkeit? Wer wurde „abgehängt“ und wo liegen die Gründe dafür?
Perspektiven: Wie lassen sich soziale Ungerechtigkeiten minimieren? Wo sollten Aufholprogramme konkret ansetzen, und welche Rolle kann das Lesen dabei spielen? Wie lassen sich Familien, Schulen und weitere gesellschaftliche Bereiche einbinden? Was braucht es, damit Kinder und Jugendliche mit Spaß und Erfolg lernen können und nicht den Anschluss verlieren?
Herausforderungen: Wie kann es gelingen, gerade junge Menschen in Risikolagen zu erreichen? Wie kann Inklusion gelingen? Wie können Digitalität und dadurch veränderte Bedingungen des Aufwachsens Berücksichtigung finden?
- Best-Practice: Frühkindliche Förderung und kulturelle Bildung von Anfang an. Gezielte Ansprache schwach Lesender. Individuelle Förderung und Lesepatenschaften.
Junge Menschen gestalten aktiv mit: Peer-to-Peer-Initiativen und Möglichkeiten der Mitbestimmung. Freiräume und Bildungskonzepte, in denen Kinder und Jugendliche sich positionieren und wirksam beteiligen können.
Zielgruppe des Symposiums:
Das Symposium richtet sich an Fachkräfte der Literaturvermittlung und Kulturellen Bildung, u.a. in den Bereichen Bibliothek, Buchhandel, freie Jugendarbeit, Forschung, Journalismus, Kita & Schule, Verlag & Autor*innen.
Mögliche Formate:
Hauptvortrag (40 Minuten)
Kurzvortrag (25 Minuten)
- Werkstattgespräch (20 Minuten / mit Vorschlägen für einzuladende Personen)
Abstracts, max. 1.500 Zeichen:
Neben einer Inhaltsskizze wird um einen Arbeitstitel gebeten, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund).
Einsendeschluss: bis 30. November 2021 an bernd@jugendliteratur.org
(Quelle: Aussendung)
CfP: Puppen-Narrative international – Literarische Puppen in Geschichte und Gegenwart
Der fünfte CfP der Zeitschrift denkste: puppe / just a bit of: doll (de:do), ein multidisziplinäres Online-Journal (mit Print-Version) für Mensch-Puppen-Diskurse, hat den Themenschwerpunkt Puppen-Narrative international – Literarische Puppen in Geschichte und Gegenwart.
Mit dem literaturwissenschaftlich akzentuierten Fokus „Puppen-Narrative international – Literarische Puppen in Geschichte und Gegenwart“ wird ein Thema aufgegriffen, das in seiner Bandbreite bislang wenig untersucht wurde. Es nimmt die Idee einer von den Herausgeberinnen vor einiger Zeit herausgegebenen Anthologie mit originär deutschsprachiger Literatur auf (Fooken u. Mikota 2016), in der sie unter dem Titel „Sollen wir Menschsein spielen?“ puppenbezogene Texte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammengestellt und kommentiert haben, die von der Zeit der Aufklärung bis in die Gegenwart reichen.
Der aktuelle CfP erweitert diesen Rahmen und fragt nach der literaturhistorischen Entwicklung der Puppenliteratur in internationalen Kontexten und Sprachräumen – von ihren frühesten Anfängen bis heute und unabhängig vom Alter der Zielgruppen. Ähnlich wie bei den Märchen, kann ein multikultureller und somit ‚internationaler Blick‘ mögliche Besonderheiten von literarischen Puppen-Narrativen erhellen, sowohl in Bezug auf allgemein-universelle Themen als auch im Hinblick auf spezifische Ausprägungen der Puppenthematik in den jeweiligen literarischen Sprachräumen. Im deutschsprachigen Raum wurden die ersten Puppengeschichten der Mädchenliteratur von Übersetzungen aus dem Französischen geprägt. In der Erwachsenenliteratur hingegen spielen seit den Anfängen der Literatur immer wieder bestimmte Puppen-Motive (z. B. Puppen als künstliche Menschen oder gendertypische Konstellationen) eine zentrale Rolle in den verschiedensten Sprachräumen, Literaturen und Kulturen. Manche dieser Narrative und Motive wurden übersetzt und sind auf eine große Resonanz in internationalen Diskurs-Kontexten gestoßen, andere wiederum sind weitgehend im eigenen Sprachraum verhaftet. geblieben.
Die Herausgeberinnen interessieren sich für alle Varianten, sowohl die Rezeption von ins Deutsche übersetzten Puppentexten als auch typische puppenbezogene literarische Traditionslinien jenseits des Deutschen.
- Gibt es sprach- und kulturspezifische Puppen-Motive und -Narrative beispielsweise in Skandinavien, in der englischsprachigen Literatur mit ihren unterschiedlichen Spielarten oder in den romanisch geprägten Sprachräumen Europas und Amerikas?
- Welche Rollen spielen Puppenerzählungen in den slawischen Sprachen? Gibt es eine besondere Puppenliteratur im „Puppenland“ Japan oder auch in anderen asiatischen Ländern?
- Wie sieht es mit den diesbezüglichen literarischen Erzähltraditionen in Afrika und überhaupt mit Puppen-Narrativen in den Sprachen und Literaturen der Welt aus?
Der Call richtet sich an unterschiedliche disziplinäre Theorie-, Forschungs- und Praxisfelder, wobei es primär darum geht, die Idee der Puppengeschichte und -erzählung in der Vielzahl ihrer literarischen, künstlerisch-kulturellen, medialen, psychologisch-pädagogischen Varianten und Erscheinungsformen auszuleuchten.
Die (wissenschaftlichen) Beiträge sollen nicht mehr als 30.000 Zeichen umfassen.
Andere Textformate sollten kürzer sein (5.000- 15.000 Zeichen).
Das angesprochene Themenspektrum ergibt sich aus den oben genannten Überlegungen.
Es sollte in jedem Fall auf interdisziplinäre Verständlichkeit geachtet werden.
Die Texte können auf Deutsch oder Englisch als elektronische-Datei beim Editorial Team (Prof. Dr. Insa Fooken, fooken@psychologie.uni-siegen.de und/oder Dr. Jana Mikota, mikota@germanistik.uni-siegen.de) eingereicht werden. Angebote für einen Beitrag werden mit einer knappen Skizze (ca. 3.500 Zeichen) und einer Kurz-Vita bis spätestens 14. November 2021 erbeten.
CfP (de & en)
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung: Literarisches Lernen mit Erstleseliteratur im Unterricht
Didaktisch-methodische Implikationen und empirische Forschungsperspektiven
Datum: 23. bis 25.06.2022
Ort: Universität Siegen
Die Gattung der „Erstleseliteratur“ wird im wissenschaftlichen Forschungsdiskurs gegenwärtig noch immer stark vernachlässigt und unterschätzt – insbesondere auch, weil sie sich häufig der (nur scheinbar verallgemeinerbaren) Kritik einer literästhetisch minderwertvollen Gestaltung stellen muss. Systematische, repräsentative, differenzierte und ausführlichere Forschungsarbeiten speziell zum literarästhetischen Potential der Erstleseliteratur stehen allerdings nach wie vor aus. Dabei ist vor allem die Erstleseliteratur jene Literatur, die Kinder selbstständig lesen (können). Die Gattung kann daher als Tor zur „literarischen Welt“ verstanden werden: Erstleseliteratur bietet, wenn sie sich auf einem literarästhetisch ansprechenden Niveau bewegt, auch unseren jüngsten Leser/innen in erster Linie gute Literatur. Der Buchmarkt hat im Bereich der Erstleseliteratur viele literarästhetisch ambitionierte Text-Bild-Kombinationen zu bieten, die in ihrem Anspruch weit über das ‚bloße‘ Lesenlernen hinausgehen.
Mit Blick auf die geplante Siegener Tagung, soll speziell das literarische Lernen mit Erstleseliteratur im Fokus stehen:
- Wie kann literarisches Lernen mit Erstleseliteratur angebahnt werden und gelingen – davon ausgehend, dass der Erwerb literarischer Kompetenz neben der Förderung von Lesemotivation und Lesekompetenz auch gerade mit Blick auf diese Gattung besonders signifikant ist?
- Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus für den Unterricht in der Grund- (und Förderschule)?
Darüber hinaus sollen auch speziell didaktisch-methodische Fragestellungen im Zentrum des Interesses stehen:
- Welche Zugangsweisen eignen sich insbesondere, um literarisches Lernen mit Erstleseliteratur (im inklusiven Unterricht und im Medienverbund) gezielt zu fördern?
- Bietet die Erstleseliteratur beispielsweise didaktisches Potential für offene Sinndeutungsprozesse im literarischen Unterrichtsgespräch?
- Erlauben auch die z.T. mitgelieferten Hörtexte zusätzliche und didaktisch sinnvolle Möglichkeiten (Lesen und Hören) nicht nur für das Lesenlernen, sondern auch speziell für das literarische Lernen?
Weitere Beitragsvorschläge sind herzlich willkommen!
Da es bislang kaum empirische Forschungsergebnisse zum literarischen Lernen mit Erstleseliteratur (in der Schule) gibt, sind Beiträge mit empirischer Ausrichtung ausdrücklich erwünscht!
Interessierte, die gerne mit einem Beitrag teilnehmen möchten, werden gebeten, bis zum 01.11.2021 ein kurzes Abstract (von ca. 300 Wörtern) und eine Kurzvita (150 Wörter) an mikota@germanistik.uni-siegen.de und schmidt@germanistik.uni-siegen.de zu senden.
Eine Rückmeldung erfolgt bis zum 30.11.2021.
Die Veranstalterinnen freuen sich auf Ihre Vorschläge!
(Quelle: Aussendung)
CfP: Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung 2022
Thema: Natur schreiben
Artenvielfalt, Klimawandel, die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren, Pflanzen und Landschaften zählen bereits seit einigen Jahren auch in der Kinder- und Jugendliteratur sowie in Kinder- und Jugendmedien zu den zentralen Themen. In Geschichten über Freundschaften zwischen Kind und Tier werden tierliche Eigenart und Handlungsmacht in den Vordergrund gerückt; Climate Fiction für Jugendliche modifiziert postapokalyptische Szenarien und phantastische Romane greifen Diskurse um Bäume, Wurzeln und ihre Netzwerke auf; Sach(bilder)bücher wollen auf teils ästhetisch avancierte Weise für die Schönheit und Vielfalt des Lebens in den Wäldern, in der Tiefe des Meeres und an den Rändern der Städte sensibilisieren – um nur einige Beispiele des in allen Genres in Erscheinung tretenden Trends zu erwähnen. Längst kann und muss in diesem Zusammenhang auch von einem sehr lukrativen Verkaufstrend gesprochen werden, die Verlage ,bedienen’ die Thematik durch immer neue
Veröffentlichungen, oftmals jedoch ohne neue inhaltliche Akzentsetzungen.
Der Blick in die aktuelle, aber auch in die historische Kinder- und Jugendliteratur zeigt dennoch, dass die Perspektiven der neomaterialistischen Theorie, der Cultural Animal- und der Cultural Plant-Studies sowie einer ökokritisch orientierten Literatur- und Medienwissenschaft hier neue bzw. Re-Lektüren hervorbringen können. Dabei ließe sich die These formulieren, dass kinder- und jugendliterarische Texte seit der Romantik von einer besonderen Verbindung zwischen Kindern und nicht-menschlichen Lebewesen geprägt sind, die sich immer schon durch eigenwillige Agency auszeichnen – insofern also andere Geschichten von Mensch-Natur-Verflochtenheiten erzählen –, die zu untersuchen wären.
Trotz der auffallenden Präsenz von Naturthemen bleiben deren Analyse und Reflexion in der Kinder- und Jugendliteratur und -medienforschung ein Desiderat. Ökokritische Ansätze konzentrieren sich bisher stark auf die Inhalts- und Repräsentationsebene, weiterhin ist ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung didaktischer Konzepte im Zusammenhang mit einem nachhaltigeren Lebensstil gerichtet. Doch gerade vor dem Hintergrund des New Materialism, aber auch des Animal Turn sowie des Plant Turn, der gegenwärtig stattzufinden scheint, zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab: Neues Wissen über das Zusammenleben von Menschen und nicht-menschlichen Wesen wird in Literatur und Medien nicht einfach repräsentiert, sondern erst beschreibend und erzählend hergestellt – es wird erschrieben. Oder, entsprechend, mit visuellen, auditiven und audiovisuellen Verfahren hervorgebracht. Dabei bedingt „Natur schreiben“ immer eine Reflexion von bislang unhintergehbaren anthropozentrischen Beobachtungs- und Erzählpositionen. Und während die Diskussion über den Klimawandel häufig abstrakt und an Zahlen orientiert bleibt, finden sich in Literatur und Medien ästhetische Verfahren, die nicht nur die Veränderung der natürlichen Mitwelt ermöglichen, sondern auch die Beziehungen zwischen Menschen und nicht-menschlichen Wesen erzählbar und sinnlich erfahrbar zu machen. Solche Versuche stehen im Mittelpunkt unseres Interesses.
Der sechste Jahrgang des open-access, peer-reviewed Jahrbuchs der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung widmet sich gegenwärtigen wie historischen Dimensionen der Beziehungen zu Natur und Landschaft in Kinder- und Jugendliteratur und -medien, insbesondere den Verfahren des Schreibens von Natur.
Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen dieses komplexen Themas sowohl aus theoretischer als auch aus gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen erzählerischen und medialen Realisierungen (Romane, Kurzprosa, Lyrik, Theaterstücke, Bilderbücher, Sachbücher, Comics, Graphic Novels, Hörmedien, Filme, TV-Serien, Computerspiele) aufgreifen.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
• Nature Writing
• Ökokritische Zugänge
• Neomaterialistische Zugänge
• Narratologie und Wissen
• Schnittstelle Naturwissen – Esoterik
• Utopie, Dystopie
• Phantastik und Worldbuilding
• Natur und Horror / dunkle Idyllen / Ökohorror / Weird Fiction
• Mensch-Natur-Beziehungen und Gender
• Materialität
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder- und jugendliterarischen bzw. -medialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch dazu wird um entsprechende Vorschläge gebeten.
Formalia:
Die Herausgeber*innen hoffen auf große Resonanz und bitten bei Interesse um die Zusendung von entsprechenden Angeboten für themenbezogene bzw. offene Beiträge in Form eines Abstracts (von nicht mehr als 300 Worten) bis zum 15.09.2021.
Die Abstracts sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung enthalten, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt. Benachrichtigungen über die Annahme des Vorschlags und die Einladung zur Einreichung eines Beitrags werden zusammen mit dem Style Sheet bis zum 15.10.2021 verschickt.
Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (inkl. Fußnoten und Literaturverzeichnis) nicht überschreiten und den Herausgeberinnen spätestens bis zum 01.03.2022 als Word-Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an:
jahrbuch@gkjf.de
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung | GKJF 2022 wird im Dezember 2022 online veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Homepage GKJF)
CfP: "Special Issue "Roaring, Golden, or Radical? The 1920s in International Children's Literature""
The 1920s have often been called the ‘Golden Twenties’, ‘the Roaring Twenties’, ‘the Jazz Age’, the ‘Années Folles’ and the time of ‘Art Renaissance’, but in many countries it has also been the time of (post-)revolution, of (financial) crisis, and of a struggle for independence.
The impact of this political, social, and cultural situation on children’s literature is manifold, ranging from urbanization, decolonization, general strikes, fascism, communism, women’s suffrage, and progressive education related to the discussion of fashion, it-girls, film stars, and popular sports.
Compared to what is often called the golden age of children’s literature, the interwar period saw a slow-down in output of children’s literature in some countries, while it flourished in others. However, various new (popular) genres emerged and many authors of adult books also wrote for children, especially in the contexts of the avant-garde and the progressive educational movement.
This volume seeks to unite different international and transnational perspectives on the 1920s, covering a wide range of literature that is regarded as ‘canonic’, ‘popular’, ‘radical’ or avant-gardist.
The aim of this Special Issue is to encourage new readings of children’s media of the 1920s in a cross-border context, considering international movements and networks as well as discussing the impact of rising nationalism and nationalist stereotypes. We would like to encourage comparative, translational, and transmedia approaches and perspectives on children’s media and material culture of the era.
References:
Druker, E./Kümmerling-Meibauer, B. (eds.) (2015): Children's Literature and the Avant-Garde, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
Papers may address topics such as:
- The 1920s as a historical and nostalgic setting (e.g., Patricia Hruby Powell/Christian Robinson: Josephine; J.K. Rowling: Fantastic Beasts and Where to Find Them; Libba Bray: The Diviners).
- Media and medialization (e.g., radio, dance, film).
- Materiality (picture books, the progressive educational movement).
- Economy and financial crisis (the children’s book market, money, and the economy as topics in children’s books).
- Children’s literature and the avant-garde (e.g., El Lissitzky, Kurt Schwitters, Lou Scheper-Berkenkamp, Lou Loeber, Einar Nerman, Vladimir Lebedev, Samuil Maršak, Daniil Charms).
- Radical children’s literature (e.g., Makimoto Kusorō, Hermynia Zur Mühlen, Bertha Lask, Alfred Kreymborg, W.E.B. Du Bois, Vladimir Mayakovski).
- Genres (crime fiction, school novels, fairy tales, etc.).
- Periodicals (such as The Brownies’ Book, Mouchak, Der heitere Fridolin and Orini, Josch and Tschisch).
- Canon, canonization, and touchstones (A. A. Milne’s Winnie-the-Pooh, Erich Kästner’s Emil and the Detectives, Monteiro Lobato’s Sítio do Picapau Amarelo, Hugh Lofting’s The Story of Dr. Doolittle, Lucy Maud Montgomery’s Emily Series, Dhan Gopal Mukerji’s Gay-Neck, the Story of a Pigeon, Ida Rentoul Outhwaite’s The Enchanted Forest or Janusz Korczak Król Maciuś, Hendrik Willem van Loon The Story of Mankind, the picturebooks by Elsa Beskow, etc.).
Please submit a 300-word abstract and short bio to bennerju@hu-berlin.de and christine.loetscher@uzh.ch by 8/1/21.
Successful applicants will be notified by 8/12/21. Papers for the special issue of Humanities are due by 2/1/22. Length of the article: 6000-7000 words.
For further information click here.
(Quelle: CfP)
CfP: Bewertungsambivalenzen. Modelle der Mehrdeutigkeiten im Kontext der Kinder-und Jugendliteratur.
27. Deutschen Germanistentag
Themenbereich 1: Theoretische und methodische Zugänge.
Kinder-und Jugendliteratur (KJL), „gemeinhin verbannt auf eigens für sie ausgewiesene Bestsel-lerlisten, Unterabteilungen der Feuilletons, in von der Belletristik abgetrennte Bücherregale in den Buchhandlungen, überschreitet die künstlich gezogene Grenze zur Allgemeinliteratur und wiederholt in einer Vielzahl, was zwanzig Jahre zuvor nur einem gelungen war: Michael Ende." (Hoffmann 2018a). Dabei sorgte die Platzierung der Unendlichen Geschichte 1980 auf der Spie-gel Bestsellerliste-Belletristik für einen Aufschrei unter den führenden Köpfen der Literaturkritik. Gleiches geschah erneut 2018, als Palutens Schmahamas-Verschwörungauf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste-Belletristik zu finden war (vgl. Conrad 2021). Und während Harry Potter vor zwanzig Jahren die Grenze zwischen Allgemeinliteratur und KJL endgültig aufgeweicht zu haben schien, stellt heute der Ruf seiner Autorin die Kanonisierung des Bestsellers ernsthaft in Frage. Das Skandalpotenzial der KJL hat im 21. Jahrhundert kaum an Brisanz verloren, im Gegenteil.
Keine andere Literatur wird als so scheinbar eindeutig rezipiert und doch mehrdeutig interpretiert, kein anderes Feld erfährtim gesellschaftlichen Diskurs eine so beständige (Neu-)Bewertung, Auf-Ab-und Umwertung, wie die KJL. Diese Mechanismen werden vor allen dann sichtbar, wenn es um die Verhandlung ambivalenter gesellschaftlicher Themen, etwa im Rahmen der Repräsentation von Diversität in Text und Bild, geht. Die komplexen Verortungen der KJL zum literarischen wie zum pädagogischen Feld ergeben nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern auch hinsichtlich ihrer literaturwissenschaftlichen und literaturkritischen Bewertung eine Ambivalenz, deren theoretische und methodische Diskussion noch lange nicht abgeschlossen ist.
Das geplante Panel widmet sich dem Versuch, dieses Phänomen der Mehrdeutigkeiten, mit dem sich die KJL seit ihren Anfängen konfrontiert sieht, und das sich in beständigen Bewertungsambivalenzen ausdrückt, theoretisch und methodisch neu zu modellieren. Prof.‘in Dr. Emer O'Sullivan (Universität Lüneburg) konnte als Keynote für das Panel gewonnen werden.
Mögliche Themenbereiche für weitere Vorträge sind:
- literatursoziologische Perspektiven ( z.B. Literaturkritik und Mechanismen der (De)kanonisierung)
- Gender und Intersektionalität
- Vermittlung und Übersetzung
- spezifische Gattungen (z.B. Graphic Novel, Bilderbuch, jugendkulturelle Formate, populäre Medien)
Vorschläge (max. 300 Wörter) für Vorträge à 20 Min. und ein kurzer wissenschaftlicher CV werden bis zum 15.07.2021 erbeten an:
Prof. Dr. Maren Conrad (maren.conrad@fau.de ) und
Dr.‘in Lena Hoffmann (le.hoffmann@em.uni-frankfurt.de)
Weitere Infomatione finden Sie hier.
(Quelle: Homepage Deutscher Germanistenverband)
CFP: Ambiguitätstoleranz? oder Mehrdeutigkeit in Kinder- und Jugendmedien aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspektive
27. Deutschen Germanistentages 2022
Doppelpanel im Themenbereich „Phänomenorientierte Zugänge“
Kinder-und Jugendmedien bewegen sich in Spannungsverhältnissen zwischen struktureller Einfachheit und Komplexität, zwischen mimetischer/diegetischer Unzuverlässigkeit und ästhetischer, thematischer sowie didaktischer/pädagogischer (‚doppelter‘) Adressatenorientierung. Sie sind geprägt von (offen markierten) intertextuellen wie intermedialen Bezügen jenseits aller nationalphilologischer Grenzziehungen und zeugen damit zugleich von einem transmedialen wie -nationalen Universalismus: Klassiker der Kinder-und Jugendliteratur sind Weltliteratur. Das Panel zielt darauf, die in vielerlei Hinsicht mehrdeutigen Erscheinungsformen moderner Kinder-und Jugendliteratur/Kinder-und Jugendmedien fachwissenschaftlich und -didaktisch zu diskutieren, und zwar sowohl im Anschluss an das allgemeine literarisch-mediale Feld als auch aus transnationaler Perspektive.
Erwünscht sind daher Beiträge, die theoretische Positionierungen im Hinblick auf die Phänomene Einfachheit und Mehrdeutigkeit, Unzuverlässigkeit und Crossover in allen an Kinder und Jugendliche adressierten Medien und Gattungen (Prosa, Dramen, Lyrik, Filme/-serien, Comics, Bilderbücher, Hörmedien) vornehmen und mit konkreten Lektüren verbinden.
Abstracts für Vorträge mit einer Länge von 25 Minuten im Umfang von max. einer Seite inkl. Literaturverzeichnis und kurzen biobibliografischen Angaben werden bis zum 15.7.2021 erbeten an:
Prof. Dr. Gabriele von Glasenapp (g.glasenapp@uni-koeln.de) und
Dr. Andre Kagelmann (andre.kagelmann@uni-koeln.de)
Arbeitsstelle für Kinder-und Jugendmedienforschung (ALEKI) Universität zu Köln
Weitere Infomatione finden Sie hier.
(Quelle: Homepage Deutscher Germanistenverband)
CFP: Vidcasts für die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse 2021
Die Oldenburger Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (OlFoKi) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg organisiert für die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse 2021 erneut das digitale Format „Wissenschaft in zehn Minuten“.
Hierbei handelt es sich um eine digitale Plattform, die Beiträge (Vid- und Podcast) versammelt, die sich mit zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur befassen.
Die große Resonanz und die sehr positiven Rückmeldungen – u.a. die Nominierung der KIBUM für den Sonderpreis Leseförderung durch die Arbeitsgemeinschaft Jugendbuchverlage e.V. (AVJ) – haben dazu ermutigt, das Projekt auch für die KIBUM 2021 fortzuführen.
Es werden daher für die KIBUM 2021 erneut Videobeiträge gesucht, die sich mit Neuerscheinungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur befassen. Die Beiträge sollten inhaltlich anspruchsvoll sein und sich einem der beiden Schwerpunkte zuordnen lassen:
a. „Für die Schule rezensiert und kommentiert“
In dieser Rubrik sollen Vid- oder Podcasts über kinder- und jugendliterarische Texte präsentiert werden, die 2020 oder 2021 erschienen sind. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Auseinandersetzung mit dem fachdidaktischen Potenzial dieser Texte für literaturspezifische Vermittlungsprozesse in Kindertagesstätten, an Schulen oder Universitäten. Ziel der Vidcasts ist es, (angehenden) Literaturvermittler*innen prägnant und anschaulich zu verdeutlichen, inwiefern diese Texte für die Vermittlung von fachlichen Kompetenzen und Bereitschaften genutzt werden können. Ebenso kann am Beispiel dieser Texte veranschaulicht werden, inwiefern innovative Verfahren Zugänge zum Gegenstand ermöglichen. Dies schließt auch digitale Zugänge zur Kinder- und Jugendliteratur ein. Adressat*innen dieser Vidcasts sind (angehende) Literaturvermittler*innen, die in unterschiedlichen Institutionen der Literaturvermittlung tätig sind (Schule, Studienseminar, Universität usw.).
b. „Ein Blick in die Werkstatt der Literaturwissenschaften“
Der zweite Themenschwerpunkt bietet literatur- oder kulturwissenschaftliche Minitaturanalysen ausgewählter kinder- und jugendliterarischer Texte, die 2020 oder 2021 erschienen sind. Hier liegt der Schwerpunkt auf einer analytischen Auseinandersetzung, die textnah einzelne Forschungsfragen skizziert und ggfs. in einen größeren Kontext stellt. Im Zentrum sollten aber stets die zu analysierenden Texte stehen, die unter literatur- oder kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden. Adressat*innen dieser Vidcast sind Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen und fortgeschrittene Studierende.
Die Beiträge dürfen auch literaturkritisch oder essayistisch ausgerichtet sein. Sie sollten ein interessiertes Publikum adressieren. Die Länge der Beiträge sollte ca. 10 Minuten betragen. Denkbar sind auch Abweichungen von dieser Zeitvorgabe, die aber abgesprochen werden müssen. Die OlFoKi freut sich sehr über Beitragsvorschläge von Wissenschaftler*innen, Nachwuchswissenschaftler*innen und fortgeschrittenen Studierenden, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur befassen.
Falls Sie Interesse an der Erstellung eines Vid- oder Podcasts haben, melden Sie sich gerne bis zum 1. Juli 2021 unter Angabe des avisierten Schwerpunkts und des Textes oder der Texte, die Sie im Rahmen Ihres Beitrags thematisieren möchten, bei: Prof. Thomas Boyken (t.boyken@uni-oldenburg.de) und Prof. Jörn Brüggemann (joern.brueggemann@uni-oldenburg.de)
Nach der Annahme des Vorschlags erhalten Sie ein kurzes style sheet, das sich v.a. auf die formalen Aspekte des Vidcasts bezieht. Die fertigen Vidcasts müssen bis zum 15. September 2021 eingereicht werden.
Weitere Informationen zur Oldenburger Buchmesse finden Sie hier.
(Quelle: H-Net - CfP)
CfP: Johanna Spyri Tagung
"Von einem Blatt auf „Vrony´s Grab“ bis zur „Stauffer-Mühle“. Johanna Spyris (1827-1901) Werk neu lesen"
Termin: 21. bis 23. Oktober 2021
Ort: Goethe-Universität Frankfurt a.M.
CfP
Vor 120 starb Johanna Spyri. Sie hinterließ eine Sammlung an Werken und Figuren, von denen eine weltbekannt wurde: Heidi, bzw. Heidi‘s Lehr- und Wanderjahre (1880) und Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (1881). Spyris frühe Erzählungen zielten jedoch auf ein erwachsenes Publikum (vgl. Ein Blatt auf Vrony’s Grab, Nach dem Vaterhause!, Aus früheren Tagen, Verirrt und gefunden). Viele Texte der Autorin sind in Vergessenheit geraten, eine Gesamtausgabe ist immer noch ein Desiderat und dieser Umstand erschwert die wissenschaftliche Arbeit. Gleichwohl gibt es noch vieles neu zu entdecken und zu kontextualisieren. Die geplante, interdisziplinär und international ausgerichtete Tagung macht sich dies zu ihrem Ziel.
Erwünscht sind Beitragsvorschläge, die sich mit aktuellen literatur- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen (etwa Ecocriticism, Gender/Queer/Masculinity Studies, Disability Studies, Posthumanismus, Animal Studies, Wissensgeschichte, New Materialism o.ä.) einer Neulektüre von Spyris Werk nähern.
Mögliche Themen sind neben der (Wieder-)Entdeckung von Spyris Texten Gattungsfragen, Figurenkonstellationen, Text/Comic und Film, Glaube und Religiosität, mediale Adaptionen, narratologische Fragen, Poetik des Coming-of-Age, Poetik des Kinderblicks, nature-culture (Stadt-Land), Mensch-Tier-Beziehungen, Inszenierung der Alpen u.ä., Fernweh, Heimat und Migration, Generationalität und Altersforschung, Illustrationen etc.
Wir bitten um Einsendungen von Beitragsabstracts (max. 500 Wörter) und kurzen bio-bibliographischen Angaben bis zum 10.05.2021 wernli@lingua.uni-frankfurt.de und christine.loetscher@uzh.ch
Die Tagung ist in Präsenz geplant, je nach epidemiologischer Situation ist eine hybride oder rein digitale Variante als alternative Option vorgesehen. Kosten für Anfahrt und Unterbringung können bei Bedarf übernommen werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Konzept und Organisation:
Prof. Dr. Christine Lötscher, ISEK Universität Zürich
PD Dr. Martina Wernli, Goethe-Universität Frankfurt a.M.
(Quelle: Aussendung)
CfP und interdisziplinärer Workshop „Zwischen Differenz und Zugehörigkeit – Religion(en) in Kinder- und Jugendmedien“
Termin: 06. und 07. Oktober 2021
Ort: Ludwig-Maximilians-Universität München
CfP
Religion und religiöse Fragestellungen werden in Kinder- und Jugendmedien auf vielfältige Weise repräsentiert und verhandelt. Die nicht selten interkulturelle und interreligiöse Auseinandersetzung reicht von (Sach-)Büchern, die sich dezidiert mit spezifischen (Welt-)Religionen, ihren Glaubensinhalten, Praktiken und Lebensweisen beschäftigen, über Neuinterpretationen und -adaptionen etwa von Schöpfungsmythen und biblischen Geschichten bis hin zu Texten, die auf philosophischer und/oder ethischer Ebene grundlegende Fragen zu Existenz und Transzendenz aufwerfen. Gerade im Kontext aktueller Debatten um Diversität und Interkulturalität wird Religion in Kinder- und Jugendmedien aber auch häufig als Kategorie von Identität, Differenz und Zugehörigkeit verhandelt.
Die Erforschung der Repräsentation von Religion und religiöser Pluralität in Kinder- und Jugendmedien erfolgt insbesondere in der Religionspädagogik, der Literaturwissenschaft und der Religionswissenschaft. Der interdisziplinäre Workshop will die intensivere Zusammenarbeit der Disziplinen stärken, indem über methodische Herangehensweisen, theoretische Konzepte und Forschungsziele diskutiert wird.
Dabei sollen Konzepte von Differenz und Zugehörigkeit im Kontext religiöser Identitäten in Kinder- und Jugendmedien verhandelt werden, wobei der Fokus auf Repräsentationspraktiken und Darstellungskonventionen in literarischen und (audio-)visuellen Quellen liegt.
Neben theoretischen Zugängen zu den Grundkonzepten Identität, Differenz und Religion sollen Positionen zu den folgenden Fragen erarbeitet werden:
- Wie wird Religion in Kinder- und Jugendmedien konzeptioniert? Welche Aspekte von Religion werden dabei fokussiert, welche bleiben unbeleuchtet?
- Inwiefern korrelieren diese Darstellungen mit gesellschaftlichen Selbstverständnissen, mit Konzepten des 'Eigenen' und 'Fremden' und mit virulenten gesellschaftlichen Entwicklungen und Diskursen?
- Welche Strategien werden verwendet, um Differenz und Zughörigkeit zu markieren?
- Gibt es Veränderungen und Konjunkturen in der Geschichte der visuellen Darstellung von Religionen? In welchem Verhältnis stehen visuelle und textuelle Repräsentationen zueinander?
Angesprochen sind insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die daran interessiert sind, aktuelle Forschungsprojekte zu diskutieren und Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Zugleich suchen wir im Rahmen des Workshops den Austausch mit Medienschaffenden, Künstlerinnen und Künstler sowie Vermittlerinnen und Vermittlern.
Um die Zusendung von Vortragsvorschlägen von 20−25 Minuten Dauer wird bis zum 14. Mai 2021 gebeten. Bitte senden Sie ein Abstract (ca. 300 Wörter), das Auskunft über Thema, Fragestellungen, Herangehensweisen, theoretische Positionen und Primärquellen gibt sowie eine biografische Notiz per E-Mail an kalbermatten@em.uni-frankfurt.de und verena.eberhardt@lmu.de.
(Quelle: CfP)
CFP (Sammelband): Tagebücher, Listen, Blogs & Co.
Selbstzeugnisse in Kinder- und Jugendliteratur und -medien
Faktuale Tagebücher und fiktionale Tagebucherzählungen, z.B. Erna Sassens Das hier ist kein Tagebuch (2017) oder Luc Blanvillains Tagebuch eines Möchtegern-Versagers (2017), nehmen seit geraumer Zeit einen immer größeren Stellenwert im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ein. Das Erzählen von sich selbst erfolgt dabei im Rahmen eines großen Formenspektrums – von der Tagebucherzählung über den Comic-Roman (Kinney, Gregs Tagebuch 2008f.) bis zur To-Do-Liste in Romanform (z.B. Hasak-Lowy, Dass ich ich bin, ist genauso verrückt wie die Tatsache, dass du du bist: Ein Roman in Listen, 2018). Und auch in anderen Medien, etwa in populären Streamingserien wie Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin (2020), orientiert sich das Erzählen strukturell und inhaltlich am Format des Tagebuchs.
Selbstzeugnisse in der Kinder- und Jugendliteratur, faktual oder fiktional, geben Rezipientinnen und Rezipienten einen meist chronologischen, fragmentarischen Einblick in einen Lebensabschnitt, der größtenteils von Konflikten im familiären Umfeld, im Freundeskreis, im schulischen Kontext sowie von Identitätsfindungsprozessen geprägt ist. Zudem werden den Tagebüchern oftmals Geheimnisse preisgegeben, die nur dem/der Verfasser_in und der Leserschaft bekannt sind. Dieses literarische Genre hat im Hinblick auf den intimen Moment des Schreibens den Charakter des Persönlichen und Privaten inne und geht mit der bereits aus dem Briefroman bekannten „Unmittelbarkeitsfiktion“ einher, die als Leseanreiz fungieren kann.
Während bei den Tagebuchromanen eine reale Autorschaft mit Hilfe einer fiktionalen Erzählinstanz und facettenreichen artifiziellen Authentizitätssignalen fingiert wird, wird das faktuale bzw. ‚echte‘ Tagebuch als Zeitdokument verstanden, das einen persönlichen Einblick in eine bestimmte (historische) Epoche gibt. Als populärstes Beispiel gilt wohl das zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Tagebuch der Anne Frank, das im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur medial vielfältig adaptiert wurde. Dabei gilt für den Umgang mit faktualen Selbstzeugnissen, dass „Zeitzeugen in Buchform […] weniger [die] historische[n] Eckdaten und die große Geschichte in den Blick nehmen, als vielmehr in kleinen Geschichten zeigen, welche Auswirkungen die Politik auf individuelle Personen hatte und hat“ (Julia Benner [2019]: „This book contains private information“. Kinder- und jugendliterarische Tagebuchliteratur, S. 22). Dieses gilt z.B. auch für die im Jahr 2015 veröffentlichten Kriegstagebücher Astrid Lindgrens.
Erwünscht sind sowohl Analysen als auch didaktische Kommentierungen einzelner (fusion) Texte, blogs, Graphic Novels und Comics, Streaming-Serien, Instagram-Stories oder weiteren Medienformaten als auch konkrete Anregungen für den Deutschunterricht aller Jahrgangsstufen. Willkommen sind ebenso Beiträge, die sich mit intertextuellen und intermedialen Bezügen neuerer KJL zu historischen Selbstzeugnissen beschäftigen und somit das Potenzial der Gegenwartsliteratur für das historische Lernen herausstellen.
Kurze Abstracts mit bio-bibliografischer Angaben werden erbeten bis zum 10.05.2021 an Inger Lison (i.lison@tu-braunschweig.de) und Jan Standke (j.standke@tu-braunschweig.de).
(Quelle: Aussendung und H-Net)
CfP "Nina Weger. Didaktische Zugänge zur Kinder- und Jugendliteratur im Netz"
Sammelband/Onlinejournal im Rahmen der didaktischen Erweiterung der Siegener Werkstattgespräche mit Kinderbuchautor*innen
Nina Weger gehört einer zeitgenössischen Generation von Autor*innen an, die ästhetische Qualität mit kindlichem Lesevergnügen auf eine besondere Art und Weise vereinen. Ihr literarisches Oeuvre ist erstaunlich vielfältig: Veröffentlicht hat Weger bislang u.a. eine Internatsreihe für Mädchen, komische Detektivromane (z.B. die Bände der Sagenhaften Saubande), abenteuerliche, lustige Räubergeschichten (Der kleine Räuber Rapido; 3 Bände) und problemsensible, realistische Kinderromane, in der sehr ernste Themen angesprochen werden (wie bspw. das Thema „Wachkoma“ in Als mein Bruder ein Wal wurde). Ihre literarischen Texte berücksichtigen komplexe Notlagen, Sorgen, Bedrängnisse und Daseinsschwierigkeiten der kindlichen Lebenswelt, verknüpfen dieser aber zugleich mit einer weniger verbissenen und gelasseneren literarischen Machart. Bislang hat sich Weger hauptsächlich der erzählenden Literatur für Kinder gewidmet. Viele Werke sind auch als Hörbuch erschienen. Der Club der Heldinnen soll bald in den Kinos laufen.
Als Anregungen für mögliche Beiträge können u.a. die folgenden Impulse dienen:
- Literaturdidaktisches Potenzial der Werke
- Leseförderung mit Texten von Nina Weger
- Literarisches Lernen mit ausgewählten Büchern; literarisches Lernen im Medienverbund
- durchgeführt und in einer eigenständigen Publikation online veröffentlicht werden.
- Inklusive Lernsettings zu exemplarischen Texten
- Inklusionssensibler Unterricht mit Texten von Nina Weger
- Projektarbeiten zum literarischen Werk
- u.v.m.
Weitere Vorschläge sind herzlich willkommen!
Interessierte Wissenschaftler*innen und/oder Didaktiker*innen, die einen Beitrag zu diesem Band leisten möchten, werden gebeten, bis zum 15.05.2021 ein Abstract (von ca. 300 Wörtern) und eine Kurzvita (150 Wörter) an die Herausgeberinnen zu senden. Neben einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung sollte das Abstract einen Bezug zu theoretischen Positionen bzw. didaktischen Konzepten und Forschungsliteratur erkennen lassen sowie Hinweise auf ausgewählte Primärtexte geben.
Die Rückmeldung über die Annahme des Beitrags erfolgt bis zum 31.05.2021, die Manuskripte (im Umfang von 10-12 Seiten) werden bis zum 31.10.2021 erwartet.
Die Herausgeberinnen freuen sich auf Ihre Vorschläge!
Dr. Jana Mikota (mikota@germanistik.uni-siegen.de)
Dr. Nadine J. Schmidt (schmidt@germanistik.uni-siegen.de)
Dr. Bettina Oeste (bettina.oeste@uni-due.de)
Informationen zu den Siegener Werkstattgesprächen finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung CfP)
CfP: libri liberorum - historische KJL
Eine Ausgabe der libri liberorum möchten wir der Vernetzung historischer Kinder- und Jugendliteraturforschung und dem Austausch spannender Forschungsergebnisse im Bereich historischer Kinder- und Jugendliteratur und -medien widmen.
Reise- und Abenteuerliteratur gehört seit der Entdeckung der Welt und des Menschen (Jacob Burckhardt) in der Frühen Neuzeit auch zu den besonders interessanten Gegenstands- und Formenfeldern der Kinder- und Jugendbücher. Im 18. und 19. Jahrhundert erlebte sie einen erstaunlichen Ausdifferenzierungsprozess: von adressatenorientiert adaptierten Reisebeschreibungen im kinder- und jugendliterarischen Werk Campes bis zu den exotischen oder nationalen (Geschichts)Abenteuerromanen von Karl May über Friedrich Gerstäcker bis Sophie Wörishöffer. Auch in der sogenannten Sachliteratur gehörten abenteuerliche, historisch- geographische Formen zu den besonders interessanten hybriden Erscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur, die zwischen Fakt und Fiktion changieren.
Erbeten werden theoretische (z.B. postkoloniale, buch- oder verlagsgeschichtliche, illustrationshistorische, poetologische, geschlechterspezifische, religionswissenschaftliche, moralgeschichtliche u.a.) oder systematische Beiträge zu Gattungen und Genres der Reise- und Abenteuerliteratur in diachroner Perspektive (einschließlich Erscheinungen wie dem Fortsetzungsroman in Periodika oder serienweise vertriebener Heftchenabenteuerliteratur). Sie können die Inhaltsebene der literarischen Erscheinungen betreffen (wie Weltbilder), aber auch die Objektebene der Materialität der Buchobjekte (z.B. Bilderwelten im Bilderbuch) und die Formen der Reise- und Abenteuerliteratur für Kinder und Jugendliche (wie z.B. den Indianerroman, das Detektivabenteuer oder Tierabenteuerbücher). Gefragt werden könnte nach dem Verhältnis der Darstellung des Fremden zwischen Natur und Kultur, nach den Spannungsfeldern der Darstellungen des Regionalen, Nationalen, Eurozentristischen oder Globalen. Ertragreich ist es auch, nach Reise- /Abenteuerromanen für Leserinnen zu fragen. In den Blick genommen werden können aber auch imagologische Phänomene wie Stereotypen, komparatistische Aspekte wie Übersetzungen von Abenteuerliteratur in das oder aus dem Deutschen, Schnittstellen zwischen Erwachsenen- und Kinder- und Jugendliteratur, (De)Kanonisierungserscheinungen der Abenteuerliteratur für diese Zielgruppe im historischen Verlauf, Prozesse der Adressatenorientierung (Kindgemäßes, Abenteuer für die Jugend), theoretisch-systematische Probleme der Gattungsentwicklungen und Gattungsdefinitionen usw.
Wir freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch an: oegkjlf@univie.ac.at
Einreichfrist ist der 1. März 2021.
Die Beiträge sollen bis 15. August 2021 einlangen.
Herausgeber*innen:
Susanne Blumesberger (Wien), Jana Mikota (Siegen) und Sebastian Schmideler (Leipzig)
CfP (de)
CfP (en)
CFP and Conference: Picturebooks in Time
Where: Tel Aviv University, Israel (hybrid-online form)
When: 3-4 October 2021
Deadline for abstracts: 26 February 2021
The program in Research of Child and Youth Culture, at Tel Aviv University, Israel invites scholars to submit proposals for The 8th International Conference of The European Network of Picturebook Research, which will take place on October 3-4, 2021.
The theme of the conference is Picturebooks in Time.
The deadline for the submission of proposals is February 26th, 2021. The conference will be held in a hybrid form, at Tel Aviv University and online.
Please send an abstract of 300 words maximum, and a short biography of 100 words in two attached Word documents to Michal Erlich: childculture@tauex.tau.ac.il
E-mails should have the subject line: Picturebooks in Time
Conference.
Please check the CfP for further information.
(Quelle: IRSCL International Research Society for Children's Literature)
CfP für das Herbstseminar des Arbeitskreises für Jugendliteratur e.V. 2021
Cancel Literature - Alte und neue Grenzen des Darstellbaren
Termin: 19. bis 21. November 2021
Ort: Katholisch-Soziales Institut, Siegburg
CfP
Das Seminar gibt einen Überblick über den aktuellen Diskussionsstand, zeigt Konfliktpotenziale auf und bietet Raum für unterschiedliche Positionen. Gleichzeitig geht es um die Frage: Welche gesellschaftlichen Kräfte beeinflussen die Entstehung von Büchern, und ist das ein Fortschritt, ein Rückschritt, ein Stück weit Pluralisierung?
Folgende Aspekte sollen betrachtet werden:
- Wie viel Einfluss hat die Zielgruppe? Wie wirkt es sich aus, wenn sich Verbände und Institutionen für Vielfalt in Kinderbüchern einsetzen und Sensitivity Reader Verlage beraten?
- Politisierung und soziale Medien: Wenn Bücher zum Politikum werden und welche Macht ein Shitstorm hat
- Welchen Einfluss haben Lizenzabteilung, Vertrieb und Buchhandel? Was ist darstellbar, wenn sich Titel (international) verkaufen müssen? Gibt es Tabuthemen für den Buchhandel?
- Kein Ende der Rollenstereotypen? Brauchen wir Mädchen- und Jungsbücher?
- Sexuelle Aufklärung und Freizügigkeit – was darf erzählt, was abgebildet werden?
- Das vermeintlich Kindgemäße – inwiefern sind thematische und stilistische Reduktionen gerechtfertigt oder sogar erforderlich?
- Inwieweit sind Autor*innen und Illustrator*innen noch Urheber*innen? Was darf zu Papier gebracht werden und wer setzt wo den Rotstift an?
- Wie umgehen mit den Klassikern? Sind sprachliche Eingriffe gerechtfertigt?
- Muss Literatur allen Ansprüchen genügen? Und inwieweit wird Kinderliteratur als Literatur wahrgenommen?
Zielgruppe der Tagung: Das Seminar richtet sich an Pädagog*innen/Lehrkräfte, Bibliothekar*innen, Buchhändler*innen, Journalist*innen, Autor*innen, Illustrator*innen, Verlagsmitarbeiter*innen sowie weitere Multiplikator*innen von Kinder- und Jugendliteratur.
Mögliche Formate:
- Hauptvortrag (45 Minuten),
- Kurzvortrag (30 Minuten),
- Arbeitsgruppe (ca. 4 Stunden)
Abstracts, max. 1.500 Zeichen: Neben einer Inhaltsskizze bitten wir um einen Arbeitstitel, ggf. Angaben zu Literatur, auf die sich der Beitrag stützt, sowie um eine Kurzvita der Einreichenden (zwei bis drei Sätze zum beruflichen Hintergrund).
Einsendeschluss: bis 15. November 2020 an bernd@jugendliteratur.org
(Quelle: Aussendung AKJ)
CfP: puppen als seelenverwandte
bedeutung der eigenen puppe(n) in biographie und künstlerich-literarischem werk
Der vierte CfP der Zeitschrift denkste: puppe / jut a bit of: doll (de:do) ein multidisziplinäres Online-Journal für Mensch-Puppen-Diskurse (mit Peer-Review), hat den Themenschwerpunkt „Puppen als Seelenverwandte – Bedeutung der eigenen Puppe(n) in Biographie und künstlerisch-literarischem Werk“. Auch unabhängig vom Schwerpunkt können freie wissenschaftliche Beiträge sowie andere Text-Formate zum Schwerpunkt wie Essays, Interviews, Rezensionen etc. zu Mensch-Puppen-Aspekten eingereicht werden. Die ersten drei Ausgaben des Journals behandeln die Schwerpunktthemen „puppen in bedrohungsszenarien“, „puppen als miniaturen“ sowie als Doppelheft „puppen/dolls like mensch – puppen als künstliche menschen“; sie sind auf der Homepage des Journals abrufbar.
Mit dem Fokus auf die Bedeutung der eigenen Puppe(n) in Biographie und künstlerisch-literarischem Werk greift dieser Call ein Thema auf, das von der Forschung bislang kaum oder nur am Rande beachtet wurde: Die Rolle und Funktion, die (eigene) Puppen im Leben von Kunstschaffenden spielen, und der Einfluss solcher Puppen bzw. puppenähnlicher, anthropomorpher Wesen auf das künstlerische und/oder literarische Schaffen. Es geht somit sowohl um die Frage nach der Wirkung früher Puppenerfahrungen im späteren Schaffensprozess als auch um die Frage nach den möglichen (biographischen) Wurzeln und Zusammenhängen von Puppenmotiv und Puppen-Narrativen im künstlerisch-literarischen Werk. Puppen sind kongeniale, aber ambigue Seelenverwandte – ‚so wie‘ Mensch und doch anders. Ihre Affordanz als Übergangsobjekt im Lebensverlauf – als Verlebendigung, Symbolisierung und ‚tote‘ Materialität – ist ein wiederkehrendes Faszinosum zwischen Anfänglichkeit (Natalität) und Endlichkeit (Mortalität). Puppen fordern dazu auf, sich auf sich selbst und offen auf die Welt einzulassen. Puppenaffine Menschen reagieren darauf in zumeist einzigartiger Weise. All das gilt für den Besitz eigener Puppen, für selbst geschaffene genauso wie für zu eigen gemachte Puppen und Puppenwelten, seien sie literarisch, zeichnerisch, filmisch, theatral oder materiell-technisch aufbereitet (z. B. Pinocchio, Sandmännchen, Babar, Barbie, Augsburger Puppenkiste, Sesamstraße). Auch wenn Puppen mit Kindheit – Kindheitserfahrungen und Kindheitsfiktionen – symbolisch aufgeladen sind, reichen sie weit darüber hinaus. Transformiert in die Formen und Inhalte der späteren Werk-Ästhetik und künstlerischliterarischen Praxis stehen sie für Zukunftsentwürfe und Potenzialität, für das, was möglich war, möglich ist und/oder möglich (gewesen) wäre. Diese Zugänge zur Welt können destruktiv und abgründig sein, konstruktiv und integrierend, sie können heilen und retten, aber auch unbestimmt in der ambiguen und liminalen Schwebe eines Dazwischen verbleiben.
Der Call richtet sich an die verschiedensten disziplinären Theorie-, Forschungs- und Praxisfelder. Es geht darum, die oben angestellten Überlegungen als ein Echo eigener Puppenerfahrungen zu verstehen und ihre Auswirkungen in literarischen, künstlerisch-kulturellen, medialen, psychologisch-pädagogischen, aber auch materiell-technischen Zeugnissen und Arbeiten auszuleuchten. Die folgende arbiträre Auflistung deutet ein vielfältiges Spektrum möglicher „Fälle“ und „Puppenspuren“ beispielhaft an. Für den Bereich der Literatur seien genannt: Goethe, E.T.A. Hoffmann, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Bruno Schulz, Walter Benjamin, Alice Herdan-Zuckmayer, Kurt Tucholsky, Else Lasker-Schüler, Klaus Mann, Halldór Laxness, aber auch Yoko Tawada, Elena Ferrante und viele mehr, nicht zuletzt in der Kinder- und Jugendliteratur: Tonke Dragt besitzt Puppenhäuser, Tony Schumacher schaffte eine Fülle von Puppenillustrationen, das Umfeld der Augsburger Puppenkiste reicht von Max Kruse bis Thomas Hettche. Aus dem Bereich Kunst und Medien lassen sich nennen: Niki de Saint Phalle, Oskar Kokoschka, James Ensor, Hans Bellmer, Morton Bartlett, Michel Nedjar, Gudrun Brüne, Cindy Sherman, Elena Dorfman, aber auch Marc Hogencamp mit Marwencol. In Robert Zemeckis Filmen tauchen wiederholt Puppen und puppifizierte Objekte auf, Marlene Dietrich hatte ihre Puppen (fast) immer dabei und der deutsche Kosmonaut Sigmund Jähn nahm das Sandmännchen mit ins Weltall.
Die (wissenschaftlichen) Beiträge sollen nicht mehr als 30.000 Zeichen umfassen. Andere Beitragsformen sollen in der Regel kürzer sein (5.000 – 15.000 Zeichen). Das angesprochene Themenspektrum ergibt sich aus den oben genannten Überlegungen. Bei allen Beiträgen soll auf interdisziplinäre Verständlichkeit geachtet werden. Die Texte können auf Deutsch oder Englisch als e-Datei beim Editorial Team (Prof. Dr. Insa Fooken, fooken@psychologie.uni-siegen.de und/oder Dr. Jana Mikota, mikota@germanistik.uni-siegen.de) eingereicht werden. Manuskriptrichtlinien sind auf der Homepage abrufbar.
Angebote für einen Beitrag werden erbitten mit einer knappen Skizze (ca. 3.500 Zeichen) und einer Kurz-Vita bis 01. November 2020.
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Homepage denkste: puppe / jut a bit of: doll (de:do))
CfP und Tagung "Internationale Konferenz #YouthMediaLife 2021"
Termin: 29. März bis 1. April 2021
Ort: Universität Wien
CfP
Menschen konstruieren, erfahren und teilen ihre Lebenswelten in mediatisierten Kulturen über ein immer komplexer werdendes Netzwerk digitaler und analoger Medienpraktiken. In der inter-disziplinären Forschungsplattform #YouthMediaLife an der Universität Wien beschäftigen sich seit Mai 2018 Wissenschaftler*innen mit mediatisierten Lebenswelten insbesondere junger Menschen. #YouthMediaLife 2021 lädt internationale Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen ein, ihre damit verbundenen Forschungsperspektiven einzubringen.
Ein besseres Verständnis der Phänomene des digitalen Wandels verlangt eine produktive Verschränkung disziplinärer und interdisziplinärer Ansätze. Wir laden daher zu Abstracts zu folgenden Themenbereichen ein:
Kommunikatives Handeln und Medienpraktiken
- Kommunikative Strukturen medialer Praktiken
- Co-Abhängigkeit von analogen und digitalen Medien
- Intergenerationelle Aspekte der Mediennutzung
- Ökonomisierung von Bedürfnissen über die Medien
- Erwartungen an mediale Leistungen (auch journalistische)
- (De-)Mediatisierungsstrategien
- Mehrsprachigkeit und ‚Translanguaging‘
- Englisch als globale Mediensprache
Individuum und Gemeinschaft
- Fragen der Identitätsbildung
- Migrantische Communities und Medienpraktiken
- Künstliche Intelligenz und junge Menschen
- Körper und Digitalität
- Medienwahrnehmung
- Körper-Raum-Wahrnehmung
- Formen der medialen Vergemeinschaftung
Forschungspraxis
- Innovative Methoden zur Erforschung von Medienpraktiken
- Feldzugang und Fragen der raum-zeitlichen Strukturierung des Feldes
- Praktische und rechtliche Fragen zur Social Media-Forschung
Politik, Ideologien und Ethik
- Ethische Aspekte der Mediennutzung
- Wahrnehmung von und Diskurse zur Medialität bzw. zu spezifischen Medienpraktiken
- Metriken und Algorithmen
- Ethische Aspekte des Einflusses von Technologien auf die Identitätsbildung
- Digitale Technologien und ‚das gute Leben‘
- Rezeptions- und Produktionsästhetik
- Kulturpessimismus, digitaler Determinismus und andere Perspektiven auf Technologien und Kultur
- Machtasymmetrien, Hegemonien und Demokratisierungsprozesse
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung
- Mehrsprachigkeit, Multiliteralitäten und Multimodalitäten
- ‚Englishisation‘ und (Sprach-)lernen
- Lernen durch Gamification
- Self-tracking und life-logging
- Konsequenzen des Medienwandels für Bildung und Persönlichkeitsentwicklung
#YouthMediaLife lädt herzlich dazu ein, Abstracts für die folgenden Präsentationsformate einzureichen:
· Individuelle Beiträge (Online oder persönlich; 20 Minuten Redezeit + 10 Minuten für Diskussion)
· Gemeinsame Panels / Symposien von insg. 90 Minuten (Online oder persönlich, 3-5 Einzelbeiträge)
Aufgezeichnete Präsentationen (z.B. Podcasts, Vidcasts oder Slideshows mit Begleitkommentar), die in extra dafür vorgesehenen online Räumen diskutiert werden.
Bitte verwenden Sie für die Einreichung das Formular auf folgender Website
(youthmedialife.univie.ac.at/einreichung)
Einreichfrist: 31.10.2020
Sie bekommen so bald wie möglich Rückmeldung, ob Ihr Abstract angenommen wurde.
Weitere Informationen zu #YouthMediaLife erhalten Sie hier.
CfP: Sammelband
Interkulturalität und Kinder- und Jugendliteratur / Interkulturelles Lernen mit Kinder- und Jugendliteratur
Der geplante Band möchte didaktische Anregungen und Modelle für den Literaturunterricht der Jahrgangsstufen 5 bis 10 präsentieren, die das interkulturelle Potential neuerer kinder- und jugendliterarischer Texte ausleuchten. Auf der Basis literaturwissenschaftlicher Analyse und didaktischer Kommentierung sollen außerdem konkrete methodische Vorschläge für die Arbeit mit Lernenden vermittelt werden.
Mögliche Texte:
Jahrgang 5 bis 6
Hayfa Al Mansour: Das Mädchen Wadjda
Kirsten Boie: Thabo. Detektiv & Gentleman (Reihe)
Ayse Bosse: Pembo
Rieke Patwardhan: Forschungsgruppe Erbsensuppe
Antonia Michaelis: Der Koffer der tausend Zauber und weitere Titel
Jahrgang 7 +
Zoran Drvenkar: Im Regen stehen
Katharine Rundell: Zuhause redet das Gras
Jahrgang 8 +
Stefanie de Velasco: Tigermilch
Susan Kreller: Elektrische Fische
Julya Rabinowich: Dazwischen: Ich
Jahrgang 9 und 10
Wolfgang Herrndorf: Tschick
Rolf Lappert: Pampa Blues
Tahereh Mafi: Wie du mich siehst
Das Redaktionsteam ist offen für weitere Vorschläge. Überblicksbeiträge zu „Klassikern“ wie Gudrun Pausewang oder Lutz van Dijk sind ebenfalls willkommen.
Die fertiggestellten Beiträge sollen einen Umfang von 45.000 Zeichen nicht überschreiten, sich mit
einem Kinder- oder Jugendbuch auseinandersetzen und bis zum 1. Mai 2021 vorliegen.
Die Gliederung der Beiträge soll einheitlich sein:
• kurze Inhaltsangabe/Textvorstellung mit Ausführungen zur angezielten Jahrgangsstufe
• knappe literaturwissenschaftliche Analyse (im Hinblick v.a. auf das interkulturelle Lernen,
z.B. hinsichtlich der Erzählperspektive(n), stilistischer Besonderheiten)
• didaktischer Kommentar I: Beschreibung des allgemeinen literaturdidaktischen Potentials
• didaktischer Kommentar II: in Bezug auf das interkulturelle Lernen
• didaktisch-methodische Konkretisierungen
Angebote für einen Beitrag werden mit einer knappen Skizze von ca. 300 Wörtern sowie einer kurzen biografischen Skizze bis zum 15. Oktober 2020 erbeten, danach erfolgt eine Rückmeldung bis Anfang November zu möglichen Beiträgen.
Die Vorschläge sind zu richten an:
Dr. Ines Heiser: ines.heiser@uni-marburg.de
Dr. Jana Mikota: mikota@germanistik.uni-siegen.de
Andy Sudermann: andy_sudermann@web.de
(Quelle: Aussendung)
CfP – Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung
THEMA: KLÄNGE
Kinder- und Jugendliteratur und ihre Medien sind stets auch eine Symphonie bzw. Polyphonie von Klängen. Bereits das Wort »Klänge« stimmt in diesem Zusammenhang ein ganzes Konzert von Assoziationen an. Der Begriff führt zu einem Spektrum an Hörphänomenen, die die komplexen Bereiche Laut/Ton, Wort/Sprache und Musik sowie Geräusche jedweder Couleur umfassen. Eine Beschäftigung mit »Klänge« impliziert zugleich die Auseinandersetzung mit Fragen der Sinneswahrnehmung(en) ebenso wie zur Klangkunst, sei es in klassischer, in experimenteller oder populärkultureller Ausprägung. Die Bandbreite literarischer Klänge erstreckt sich von den vielgestaltigen Aspekten des Lyrischen (des Liedes, der lyrics etc.) zu Fragen intermedialer Referenzen, die sich an Texten ablesen lassen, bis hin zum spezifischen Sound und Soundtrack in Kinder- und Jugendmedien. Dabei tönt und dröhnt es nicht allein aus jugendliterarischen Texten, Klänge werden beispielsweise auch in Bilderbüchern hörbar. Politische wie ideologische Botschaften klingen an; narratologische Fragen kommen ins Spiel, wenn zum Beispiel von der Stimme des Erzählers oder dem kindgemäßen Ton die Rede ist oder vom schnellen Beat eines Romans. Klänge werden durch Sprachmelodien eingewoben, durch fremdsprachliche Zitate eingespielt, durch montierte und collagierte Geräusche dem Text unterlegt. In Klängen bildet sich zwitschernd und rauschend Natur ab, die (literarische, komponierte) Symphonie der Großstadt setzt Metropolen ein Sound-Denkmal. Auch in medialen Kontexten – im Bereich der Hörmedien ebenso wie in Bild-Medien – spielen Klänge eine ganz zentrale Rolle. Zu fragen ist deshalb nach den Zusammenhängen von Klang und Medien bzw. Medienentwicklung im Spiegel aller kinder- und jugendmedialen Produkte und Praxen.
Das open access, peer-reviewed Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung stellt 2021 das Thema KLÄNGE in den Mittelpunkt, um historische wie gegenwärtige Dimensionen dieses komplexen Gegenstands in den Blick zu nehmen. Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen dieses Themenkomplexes sowohl aus theoretischer wie gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen Gattungsschwerpunkten wie medialen Gestaltungsformen (Bilderbücher, Comics, Graphic Novels, Filme, Fernsehen, Computeranwendungen) aufgreifen und zugleich vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für die heutige Kinder- und Jugendmedienforschung diskutieren.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
• Sprachformen | Erzählformen | Narrative
• Intermedialität und Materialität
• Bild-Medien (insbesondere Bilderbuch, Graphic Novels)
• Interdisziplinäre Aspekte der Klang-Künste
• Hörmedien
• Audiovisuelle Medien: Filme, Serien, …
• Sinneswahrnehmungen | Gefühlsforschung
• Musik und Gesang
• Politische Aspekte, ideologische Implikationen (Stichwort RechtsRock)
• Anthropologische Fragestellungen
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder- und jugendmedialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch hier bittet die GKJF um entsprechende Vorschläge.
Formalia:
Die GKJF hofft auf große Resonanz und bittet bei Interesse um die Zusendung von entsprechenden Angeboten für themenbezogene bzw. offene Beiträge – zunächst (d.h. bis zum 15.9.2020) in Form eines Abstracts von nicht mehr als 300 Wörtern. Die Abstracts sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung machen, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt. Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (inkl. Fußnoten und Literaturverzeichnis) nicht überschreiten und den Herausgeberinnen spätestens bis zum 1.3.2021 als Word-Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an: jahrbuch@gkjf.de
Ein Style Sheet wird nach Annahme der Abstracts verschickt.
Das Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung | GKJF 2021 wird im Dezember 2021 online veröffentlicht.
Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung | GKJF Herausgeberinnen
Prof. Gabriele von Glasenapp, Universität zu Köln
Prof. Emer O’Sullivan, Leuphana Universität Lüneburg
Prof. Caroline Roeder, PH Ludwigsburg
Prof. Ingrid Tomkowiak, Universität Zürich
(Quelle: Hompage GKJF)
CFP: Sammelband „Genderaspekte in der Kinder- und Jugendliteratur. Synchrone und diachrone Perspektiven von den Anfängen bis zur Gegenwart“
In dem geplanten Band soll die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur erstmals systematisch in ihrer diachronen Entwicklung unter Genderaspekten aufgearbeitet und dargestellt werden. Erwünscht sind daher Beiträge zu den verschiedenen literarischen Epochen, die jeweils einen Überblick über die Genderkonstrukte der jeweiligen Epoche mit Bezügen zu den herrschenden pädagogischen Diskursen der Zeit sowie ein oder mehrere Fallbeispiele beinhalten.
Beitragsvorschläge (max. 1 DIN A4-Seite) nebst einem kurzen CV senden Sie bitte bis zum 14.06.20 an die Herausgeberin Prof. Dr. Weertje Willms (weertje.willms@germanistik.uni-freiburg.de).
Über die Annahme der Beiträge werden Sie bis zum 21.06.20 informiert. Die Beiträge sollen bis zum 31.10.20 vorliegen und ca. 40.000-50.000 Zeichen (incl. Leerzeichen) umfassen.
(Quelle: Aussendung)
CfP "Kulturelle Nachhaltigkeit lernen und lehren“
Workshop und Sammelband der PH NÖ im Rahmen des Projekts „Das Anthropozän lernen und lehren“
Termin: 22. und 23. April 2021
Ort: Pädagogischen Hochschule NÖ am Campus Baden
Das interdisziplinäre Projekt „Das Anthropozän lernen und lehren“ nutzt das Anthropozän als Denkrahmen für transformative Bil-dungsprozesse und als Reflexionsbegriff für eine Weiterentwicklung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der geologische Fachbegriff, das Anthropozän, fordert dazu auf, über die Notwendigkeit und die Möglichkeit einer zukunftsorientierten Neugestaltung der Mensch-Natur-Beziehung nachzudenken.
Der zweite Workshop und Sammelband Kulturelle Nachhaltigkeit lernen und lehren fokussiert das transformative Potenzial kulturel-ler Praktiken, Produkte, Perspektiven in Bildungsprozessen. Ausgangspunkt dafür ist ein Verständnis von kultureller Nachhaltigkeit als Querschnittsthema, „weil jede Art der Thematisierung [von Nachhaltigkeit] immer kulturell vermittelt wird, d. h. auf bestimmten Wahrnehmungsmustern, Erkenntnismethoden, Wissensbeständen und Werten beruht.“ (Rippl 2019, 316) Im Zentrum steht daher die Frage nach der Bedeutung und den Möglichkeiten von kultureller Nachhaltigkeit als Bildungskonzept für eine gesamtgesell-schaftliche Transformation, deren Ziel der Schutz und die Sicherung der menschlichen und nichtmenschlichen Lebensbedingungen im Anthropozän ist.
Erbeten sind daher Beiträge sowohl aus dem Feld der Konzept- als auch der empirischen Forschung, die sich im Rahmen folgender Fragestellun-gen bewegen:
- Welche Rolle können Literatur und Kunst in ihren vielfältigen Ausdrucksformen, als Orte „einer ständigen, kreativen Selbster-neuerung von Sprache, Wahrnehmung, Imagination und Kommunikation“ (Zapf 2015, 177), in einer Bildung für kulturelle Nach-haltigkeit spielen?
- Welche Lehr-Lernprozesse können kulturelle Nachhaltigkeit befördern? Wie können sie evaluiert werden?
- Welche didaktischen Konzepte braucht eine Bildung für kulturelle Nachhaltigkeit?
- Welche Lernszenarien ermöglichen die Decodierung der Vergangenheit als kulturelles Gedächtnis?
- Welche Lernszenarien setzen sich mit Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft auseinander?
- Wie sind diese Lernszenarien in Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II mathetisch umsetzbar?
- Welche kulturpädagogische theoretische Fundierung bietet sich für transformative Bildungsprozesse an, die das Themenfeld Mensch – Natur – Kultur – Umwelt bzw. Unswelt (Leinfelder 2012) fokussieren?
Abstracts möglicher Beiträge im Umfang von etwa 400 Wörtern mit Angabe von fünf bis sechs Keywords und einer kurzen biografischen Info inkl. E-Mail-Adresse der Autorin/des Autors bitte bis 1. September 2020 an carmen.sippl@ph-noe.ac.at senden.
(Quelle: Aussendung)
CfP: Kibum 2020
Für die Kibum im November 2020 ruft die Oldenburger Forschungsstelle heuer, aufgrund des derzeit nicht abschätzbaren Verlaufs der Corona-Pandemie, zur Erstellung von Vidcasts auf, die sich mit gegenwärtiger Kinder- und Jugendliteratur befassen. Im Zentrum soll die Buch- und Medienproduktion des Jahres 2020 stehen. Angesprochen sind Wissenschaftler*innen, Nachwuchswissenschaftler*innen und fortgeschrittene Studierende, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur befassen.
Die Beiträge sollten sich einem der folgenden drei Schwerpunkte zuordnen lassen:
a. „Für die Schule rezensiert und kommentiert“
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Fragen der didaktischen Eignung, insbesondere im schulischen Kontext. Es kann diskutiert werden, inwiefern die Medien für Kinder und Jugendliche interessant sein könnten und inwiefern sie Potenzial für literaturspezifische Vermittlungsprozesse in Kindertagesstätten, an Schulen oder Universitäten besitzen. Adressat*innen dieser Vidcasts sind (angehende) Literaturvermittler*innen, die in unterschiedlichen Institutionen der Literaturvermittlung tätig sind (Schule, Studienseminar, Universität usw.).
b. „Kinder- und Jugendliteratur 2020: Trends und andere Beobachtungen“
Diese Vidcasts sind eher literaturkritisch, feuilletonistisch und essayistisch ausgerichtet. Es dürfen gerne subjektive Leseerlebnisse geschildert und in Bezug zu anderen Texten gesetzt werden. Darüber hinaus sollten die Einzellektüren in einen größeren Kontext gestellt werden, der wiederum auch thematische Schwerpunkte markieren kann. Die Adressat*innen dieser Vidcasts sind v.a. Erwachsene, die nicht dezidiert im Kontext der Literaturvermittlung stehen.
c. „Ein Blick in die Werkstatt der Literaturwissenschaften“
Der dritte Themenschwerpunkt bietet literatur- oder kulturwissenschaftliche Minitaturanalysen ausgewählter kinder- und jugendliterarischer Texte des Jahres 2020. Hier liegt der Schwerpunkt auf einer analytischen Auseinandersetzung, die textnah einzelne Forschungsfragen skizziert und ggfs. in einen größeren Kontext stellt. Im Zentrum sollten aber stets die zu analysierenden Texte stehen, die unter literatur- oder kulturwissenschaftlicher Perspektive besprochen werden. Adressat*innen dieser Vidcast sind Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen.
Die Länge der Vidcasts sollten max. 10 Minuten betragen. Denkbar sind auch Abweichungen von dieser Zeitvorgabe, die aber abgesprochen werden sollten. Falls Sie Interesse an der Erstellung eines Vidcasts haben, melden Sie sich gerne bis zum 1. August 2020 unter Angabe des avisierten Themenschwerpunkts und des Textes oder der Texte, die Sie im Rahmen Ihres Beitrags perspektivieren möchten, bei: Prof. Jörn Brüggemann (joern.brueggemann@uni-oldenburg.de) und Prof. Thomas Boyken (t.boyken@uni-oldenburg.de).
Nach der Annahme des Vorschlags erhalten Sie von uns ein kurzes style sheet, das sich v.a. auf die formalen Aspekte des Vidcasts bezieht. Die fertigen Vidcasts müssen bis zum 15. September 2020 eingereicht werden, damit die Dateien rechtzeitig zur Eröffnung der Kibum 2020 online zur Verfügung stehen können.
Es wird zur Herstellung der Vidcasts die frei zugängliche Software OBS empfohlen.
Weitere Informationen zur Kibum finden Sie hier.
(Quelle: CfP H-Germanistik)
CfP und Tagung "Internationale Konferenz #YouthMediaLife 2021"
Termin: 29. März bis 1. April 2021
Ort: Universität Wien
CfP
Menschen konstruieren, erfahren und teilen ihre Lebenswelten in mediatisierten Kulturen über ein immer komplexer werdendes Netzwerk digitaler und analoger Medienpraktiken. In der inter-disziplinären Forschungsplattform #YouthMediaLife an der Universität Wien beschäftigen sich seit Mai 2018 Wissenschaftler*innen mit mediatisierten Lebenswelten insbesondere junger Men-schen. #YouthMediaLife 2021 lädt internationale Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen ein, ihre damit verbundenen Forschungsperspektiven einzubringen.
Ein besseres Verständnis der Phänomene des digitalen Wandels verlangt eine produktive Ver-schränkung disziplinärer und interdisziplinärer Ansätze. Wir laden daher zu Abstracts zu folgenden Themenbereichen ein:
Kommunikatives Handeln und Medienpraktiken
- Kommunikative Strukturen medialer Praktiken
- Co-Abhängigkeit von analogen und digitalen Medien
- Intergenerationelle Aspekte der Mediennutzung
- Ökonomisierung von Bedürfnissen über die Medien
- Erwartungen an mediale Leistungen (auch journalistische)
- (De-)Mediatisierungsstrategien
- Mehrsprachigkeit und ‚Translanguaging‘
- Englisch als globale Mediensprache
Individuum und Gemeinschaft
- Fragen der Identitätsbildung
- Migrantische Communities und Medienpraktiken
- Künstliche Intelligenz und junge Menschen
- Körper und Digitalität
- Medienwahrnehmung
- Körper-Raum-Wahrnehmung
- Formen der medialen Vergemeinschaftung
Forschungspraxis
- Innovative Methoden zur Erforschung von Medienpraktiken
- Feldzugang und Fragen der raum-zeitlichen Strukturierung des Feldes
- Praktische und rechtliche Fragen zur Social Media-Forschung
Politik, Ideologien und Ethik
- Ethische Aspekte der Mediennutzung
- Wahrnehmung von und Diskurse zur Medialität bzw. zu spezifischen Medienpraktiken
- Metriken und Algorithmen
- Ethische Aspekte des Einflusses von Technologien auf die Identitätsbildung
- Digitale Technologien und ‚das gute Leben‘
- Rezeptions- und Produktionsästhetik
- Kulturpessimismus, digitaler Determinismus und andere Perspektiven auf Technologien und Kultur
- Machtasymmetrien, Hegemonien und Demokratisierungsprozesse
Bildung und Persönlichkeitsentwicklung
- Mehrsprachigkeit, Multiliteralitäten und Multimodalitäten
- ‚Englishisation‘ und (Sprach-)lernen
- Lernen durch Gamification
- Self-tracking und life-logging
- Konsequenzen des Medienwandels für Bildung und Persönlichkeitsentwicklung
#YouthMediaLife lädt herzlich dazu ein, Abstracts für die folgenden Präsentationsformate einzureichen:
- Poster, die in eigenen ‚poster sessions’ präsentiert werden (max. 200 Wörter)
- Individuelle Beiträge (20 Minuten Redezeit + 10 Minuten für Diskussion; max. 350 Wörter)
- Gemeinsame Panels / Symposien von insg. 90 Minuten (max. 350 Wörter für das Rahmenabstract und max. 200 Wörter für jeden individuellen Beitrag; 3-5 Einzelbeiträge)
Bitte verwenden Sie für die Einreichung das Formular auf folgender Website
(youthmedialife.univie.ac.at/einreichung)
Einreichfrist: Fr, 17.07.2020
Sie bekommen bis zum 30.10.2020 Rückmeldung, ob Ihr Abstract angenommen wurde.
Weitere Informationen zu #YouthMediaLife erhalten Sie hier.
CfP libri liberorum, Heft 54
Libri liberorum, die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung, wurde im Jahr 2000 als Mitteilungsblatt der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF,) gegründet, 2010 in eine wissenschaftliche und 2016 in eine peer reviewte Zeitschrift umgewandelt. Ab der 51. Ausgabe erscheint sie auch open access. Das Ziel der Zeitschrift ist die Erforschung der historischen und aktuellen Kinder- und Jugendliteratur mit Schwerpunkt auf Themen über und aus Österreich. Sie dient als Kommunikationsplattform und als Informationsforum für ExpertInnen und Interessierte im In- und Ausland. Neben wissenschaftlichen Fachbeiträgen werden auch Berichte aus der Praxis, Miszellen und Rezensionen angenommen.
Nach einigen themenspezifischen Heften (siehe auch hier) möchten wir das Heft 54 thematisch für spannende Forschungsergebnisse im Bereich historischer oder zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur und -medien öffnen und freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch bis zum 15. Juli 2020 an: oegkjlf@univie.ac.at
Das Redaktionsteam
Susanne Blumesberger
Petra Herczeg
Stefan Krammer
Wynfrid Kriegleder
Susanne Reichl
Sonja Schreiner
CfP (de, en)
CfP "Children’s Literature and Climate Change"
Special Issue of The Lion and the Unicorn
Marek Oziewicz (University of Minnesota) and Lara Saguisag (University of New York) seek essays on how children’s literature empowers young people to productively engage with the challenges of climate change.
Possible topics include, but are not limited to:
- The role of children’s literature on climate change in raising young people’s awareness about their responsibility to the biosphere;
- Depictions of climate change across various genres and forms, including picturebooks, chapter books, comics, short stories, and novels;
- Films, apps, music, and games that engage with climate change and seek to mobilize youth action;
- Constructions of childhood in climate change narratives and discourses;
- Climate change and youth participation in community protests, political campaigns, nonviolent civil disobedience, ecotage (ecosabotage), and ecorism (ecoterrorism);
- Climate change narratives about and by Indigenous youth and youth of color, who are often at the forefront of climate justice initiatives and whose communities are disproportionately threatened by climate change;
- Children's and YA books that link responsibility to climate change with, in the words of Kim Q. Hall, “commitments to futures that are queer, crip, and feminist”;
- Depictions of environmental racism and classism as facets of climate change;
- Climate change and human migrations, including stories about climate refugees;
- Comparative studies of children's and YA literature on climate change published in the global north and the global south;
- Visions of climate futures, including discourses of hope or despair;
- Reimagining and restructuring institutions of children’s literature that depend on, profit from, and support polluting, extractive industries;
- Intersections of critical discourse on climate change and children’s literature scholarship, including new taxonomies and emerging genres apposite to the challenges of conceptualizing climate change, from environmental literature and cli-fi to eco-fiction and beyond;
- Reevaluations of existing literary traditions through new theoretical concepts or approaches such as energy humanities, environmental humanities, indigenous futurisms, the Anthropocene, ecocritical posthumanism, and other lenses.
Essays should be sent to guest editors Marek Oziewicz and Lara Saguisagat LU.Climateissue@gmail.com by July 15, 2020.
Submissions should be in the range of 4000 to 8000 words (although we will also consider shorter, forum-length essays). Accepted articles will appear in The Lion and the Unicorn, vol.45, no. 2 (2021).
(Quelle: Homepage kinderundjugendmedien)
CfP "Jeunesse: Young People, Texts, Cultures"
Published by the Centre for Research in Young People’s Texts and Cultures (CRYTC) at the University of Winnipeg, Jeunesse: Young People, Texts, Cultures is a scholar-led, interdisciplinary, refereed academic journal whose mandate is to publish research on and to provide a forum for discussion about cultural productions for, by, and about young people.
The scope is international; while they have a special interest in Canada, they welcome submissions concerning all areas and cultures. The focus of the journal is on the cultural functions and representations of “the child.” This can include, but is not limited to:
- children’s and young adult literature and media;
- young people’s material culture, including toys;
- digital culture and young people;
- historical and contemporary constructions, functions, and roles of “the child”;
- literature, art, film, and television by/for children and young adults.
Articles in English and French are welcome.
Please submit articles by May 1, 2020 to be considered for our general Winter 2020 issue (12.2).
More information on how to submit papers and how to subscribe can be found here.
Review essay, forum, and resource sections are open access.
(Quelle: CfP webpage Jeunesse)
CfP und Studientagung "Faszination Nibelungen"
Präsenz und Vermittlung eines multimedialen Mythos
Transdisziplinäre Studientagung und Lehrerfortbildung an der Universität Passau
Termin: 24. bis 26. September 2020
Ort: Universität Passau,
Das Nibelungenlied − einer der bedeutendsten Texte des Mittelalters, zugleich Weltliteratur und lange Zeit deutscher Nationalmythos − ist heute fesselnd wie vor über 800 Jahren. Uns faszinieren daran vor allem die menschlichen Grundkonflikte: Liebe und Hass, Treue und Verrat – und wie unterschiedlich diese von den Rezipierenden gesehen und bewertet wurden.
Die Tagung an der Universität Passau hat zum Ziel, die multimediale Präsenz des Nibelungen-Mythos vom Mittelalter bis in die Gegenwart zu untersuchen und dessen Potential neu auszuloten. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Vermittlung in der Schule und einer breiteren Öffentlichkeit liegen. Der dabei anvisierte Brückenschlag zwischen der Älteren Deutschen Literaturwissenschaft, der Deutsch-Didaktik sowie weiteren literatur- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen soll dabei nicht zuletzt zeigen, dass der Nibelungen-Mythos bis heute ein lohnender Gegenstand für eine wissenschaftliche und praxisorientierte Auseinandersetzung ist.
Da die Tagung im Format einer Studientagung und Lehrerfortbildung durchgeführt wird, sind als weitere Beiträge Einzelvorträge, Workshops sowie Posterpräsentationen vorgesehen. Bevorzugt Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wird in 30-minütigen Vorträgen bzw. in kurzen Posterpräsentationen Gelegenheit gegeben, neue Konzepte und Ideen exemplarisch vorzustellen und zu diskutieren.
Der rote Faden, der alle Beiträge verbindet, soll der Nibelungen-Mythos in der Version des um 1200 verschriftlichten Nibelungenliedes sein. Darüber hinaus sind Schwerpunktbildungen mit Blick auf spezifische Themen (Gefühle, Gewalt, Verrat etc.), auf verschiedene literatur- und kulturwissenschaftliche Ansätze (Gender Studies, Intersektionalität, Mediensemiotik, Narratologie, Performativität etc.) oder mit einem besonderem Fokus auf die didaktischen Vermittlungsprozesse unter Einbezug aktueller literatur-, sprach- und mediendidaktischer Konzepte und Theoriebildungen denkbar. Neben Beiträgen zu mittelalterlichen Versionen des Nibelungen-Mythos von den Leithandschriften A,B und C des UNESCO-Weltdokumentenerbes über die Illustrationen im Hundeshagenschen Codex bis hin zu Hans Sachsʼ Tragödienbearbeitung sind auch Beiträge zu modernen Rezeptionsweisen in Artefakten, Bildern, Kinder- und Jugendliteratur, Computerspielen, Fantasy, Filmen, Comics und Graphic Novels, Museen, Musik, Performances, Serienformaten oder Theaterinszenierungen willkommen. Bei didaktischen Arrangements ist zu beachten, dass ältere Texte und Medien noch erhältlich sind und zu unterrichtlichen Zwecken sinnvoll einsetzbar sein sollten.
Aussagekräftige Exposés zu einem der drei Beitragsformate (Vortrag, Poster, Workshop) im Umfang von nicht mehr als einer Seite schicken Sie bitte zusammen mit kurzen Angaben zur Person bis zum 15. März 2020 an karla.mueller@uni-passau.de und andrea.sieber@uni-passau.de.
(Quelle: Aussendung CfP)
CfP libri liberorum Heft 53
Kindgerechte „Arbeit am Mythos“
Moderne Rezeptionsstrategien von der Adaptation bis zur Transformation
Mythische Elemente und Motive, mythologisches Kolorit sowie Figurenrepertoire aus Mythen sind in den Kinder- und Jugendliteraturen auf allen Kontinenten in vielfältiger Weise verankert und haben aufgrund der Akzeptanz bei den Leser*innen und dem damit verbundenen Identifikationspotential Eingang in den multimedialen Raum der Kinder- und Jugendkultur gefunden. lili 53 (2020) sucht Beiträge (vorzugsweise in deutscher oder englischer Sprache), die sich dem schier unerschöpflichen Themenfeld aus unterschiedlichsten Blickwinkeln nähern: Neben dem traditionell literarischen Zugang (incl. Sach- und Schulbuch) sind vergleichende Untersuchungen zu Filmen, Spielen und künstlerischer Aneignung willkommen. Ein Blick über Europa und den „klassisch“ griechisch-römischen Mythenfundus hinaus ist dezidiert angestrebt.
Wir freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch bis zum 31. März 2020 an: oegkjlf@univie.ac.at
CfP (dt./engl.)
CfP and workshops “This is my story”
“This is my story” - focus on biographical and autobiographical narratives in the EFL classroom
Second storytelling conference at the PHZH / Zurich University of Teacher Education
time: September 3 and 4, 2020
venue: PHZH in Zurich
In 2013 our first storytelling conference brought 190 participants from 13 different countries to Zurich. Seven years later, the world has moved on but storytelling still captivates students and learners. Hence, the Zurich University of Teacher Education is organising a second conference to celebrate storytelling and reading as a window on the world and as a key stimulus to support learning in a foreign language.
The two-day conference, “This is my story”, puts the focus on biographical and auto-biographical narratives and writings and ways of implementing such texts in the EFL classroom. The conference aims to bring together authors, illustrators, storytellers, teachers, researchers and teacher educators from all educational levels. We would like to present a unique blend of theory of practice through paper presentations, workshops, lectures and storytelling.
Conference topics
For the presentations and workshops the organising committee would like to encourage contributions based on biographical / autobiographical texts particularly from the following fields:
- Fiction of migration, culture and identity
- Adventure / crime stories
- Coming of age stories
- Historical fiction
Regarding the form of the texts, the organising committee is open to narratives across the media (novels, plays, poetry, picturebooks, graphic novels and comics, film, tv series, audiobooks and audioplays) and hope for an interesting mix.
Individual paper sessions are 45 minutes long, with 30 minutes for presentation and 10 minutes for discussion. Workshops are 90 minutes long and are expected to involve the participants in activities. The conference language is English.
Due date for abstracts: January 20, 2020
The organising committee kindly ask you to submit an abstract (up to 300 words and a short biography of 80 words, in a Word document) to the following email address: phzh.englisch@phzh.ch
Notification of acceptance: March 1, 2020
Organising committee: Nikola Mayer, Michael Prusse, Regula Fuchs, Laura Loder-Büchel
(Quelle: Aussendung)
CfP und Tagung „Philosophische Fragen im Spiegel der Kinder- und Jugendliteratur“
Symposion der Oldenburger Forschungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (OLFOKI)
Termin: 10. bis 12. November 2020
Philosophische Fragen, Gedanken und Haltungen spielen medienübergreifend in vielen Texten der Kinder- und Jugendliteratur eine Rolle. Dass ihre literarische bzw. ästhetische Gestaltung ein besonderes Potenzial für die Modellierung fachlicher Bildungsprozesse birgt, die auf Problemorientierung im Bereich des menschlichen Denkens, Erkennens und Handelns sowie die reflexive Erweiterung des eigenen Selbst-Welt-Verhältnisses zielen, ist eine Annahme, die im Diskurs der Literatur- und Philosophiedidaktik gleichermaßen kursiert. Diese Annahme soll im Rahmen des Symposions expliziert und zur Diskussion gestellt werden. Dabei ist der OLFOKI eine relationale Herangehensweise wichtig:
Aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen (Literaturwissenschaft, Literatur- und Philosophiedidaktik) soll am Beispiel von aktuellen und historischen Texten der Kinder- und Jugendliteratur expliziert, konkretisiert und veranschaulicht werden, worin dieses Potenzial besteht, wie es sprachlich, literarisch oder medial erzeugt wird, mit welchen fachspezifischen Anforderungen es korrespondiert und wie es im Rahmen sprachlicher, literarischer und philosophischer Bildungsprozesse erschlossen und genutzt werden kann.
Auf diese Weise soll einerseits ein Bewusstsein für fach- bzw. domänenspezifische Anforderungen und Erwartungen geschärft werden, andererseits aber auch ein Horizont für die Verständigung über philosophische Implikationen sprachlicher und literarischer (Lern-)Gegenstände, Erkenntnisweisen und Lehr-Lernprozesse entwickelt werden, die mit Hilfe ausgewählter Texte der Kinder- und Jugendliteratur erschlossen werden können.
Basis ist ein weiter Begriff von Kinder- und Jugendliteratur, der unterschiedliche mediale Formen umfasst (z.B. auch Hörmedien, Comics, Graphic Novels, Filme, Computerspiele etc.).
Es werden Beiträge erbeten, die sich z.B. mit einer der folgenden Fragen auseinandersetzen:
· Wie und zu welchem Zweck thematisieren aktuelle und historische Texte der Kinder- und Jugendliteratur philosophische Fragen, Probleme und Haltungen?
· Worin bestehen die philosophischen Potenziale der Kinder- und Jugendliteratur? Wie werden sie sprachlich, literarisch, rhetorisch und medial konstituiert?
· Wie lassen sich literarästhetische und philosophische Bildungspotenziale im Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur identifizieren, voneinander abgrenzen, zueinander in Beziehung setzen und realisieren?
· Wie lassen sich philosophische Kontextualisierungen kinder- und jugendliterarischer Texte im Literaturunterricht legitimieren und als Konzept sprachlicher und literarästhetischer Bildung profilieren?
· Wie lassen sich philosophische Fragen in der KJL für literarästhetische Lernprozesse nutzbar machen?
· Welche Funktionen haben kinder- und jugendliterarische Texte im Horizont philosophischer Bildungsprozesse?
· Welche Bilderbücher eignen sich zum Philosophieren mit jungen Kindern?
· Welche Formate des Philosophierens mit Kindern lassen sich mittels Kinder- und Jugendliteratur umsetzen?
· Was unterscheidet philosophische Gespräche von literarischen Gesprächen über Kinder- und Jugendliteratur? Was verbindet sie?
· Inwiefern sind (aktuelle) Texte der Kinder- und Jugendliteratur geeignet, philosophische (Grund-)Fragen aufzuwerfen, die die philosophische Prägung fachlicher Gegenstände und Erkenntnisweisen deutlich machen? Inwiefern können sie einen Sinn für fachliche Erkenntnisweisen vermitteln?
Ausdrücklich erwünscht sind außerdem Beiträge von Deutsch- und Philosophielehrer/innen bzw. -fachleiter/innen, die am Beispiel eines gemeinsam gewählten kinder- oder jugendliterarischen Textes aus der Sicht des jeweiligen Faches konkretisieren, worin das fachspezifische Potenzial dieses Textes besteht und auf welche Weise er sinnvoll in fachliche Lehr-Lernprozesse eingebunden werden könnte.
Der Call for Papers wendet sich an Forschende unterschiedlicher Disziplinen, insbesondere der Kinder- und Jugendliteraturforschung, der Deutsch- und Philosophiedidaktik sowie an Lehrende an Schulen und Fachseminaren. Im Anschluss an die Tagung ist die Publikation der Beiträge in einem Tagungsband geplant.
Bitte senden Sie bis zum 15. Februar 2020 ein Abstract (250 Wörter) an:
christa.runtenberg@uni-oldenburg.de sowie joern.brueggemann@uni-oldenburg.de.
(Quelle: Aussendung CfP)
CfP und Tagung "Urban! Städtische Kulturen in Kinder- und Jugendmedien"
33. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
Termin: 11. bis 13. Juni 2020
Ort: Gustav-Stresemann-Institut Bonn (GSI)
Die städtische Lebenswelt bildet in Geschichten für Kinder und Jugendliche heute eine selbstverständliche Kulisse. Als literarischer oder filmischer Handlungsraum hat sich die Stadt, vor allem die Großstadt, sowohl als Erscheinungsform als auch in der Deutung in Kinder- und Jugendmedien innerhalb von etwa 150 Jahren grundlegend gewandelt. Von einem rasant wachsenden, hektischen, lauten und verschmutzten Asphaltdschungel als Kontrastfolie zum vermeintlich heilen Landleben entwickelte sie sich, etwa in den klassischen Romanen der Weimarer Republik, zu einem von kindlichen Akteuren eroberten Eigenraum, zu einem sozialkritisch betrachteten Abenteuerspielplatz kultureller Diversität und zu einer konstruierten, modernen und innerhalb der Stadtgrenzen von (kulturellen) Gegensätzen bestimmten Lebenswelt, in der die heranwachsenden Protagonist*innen sich zurechtfinden müssen, die ihnen gesetzten Grenzen überschreiten und die von besorgten Erwachsenen vorgegebenen Deutungen unterlaufen. Ein nie da gewesenes Maß an Lern-, Konsum- und Freizeitmöglichkeiten wird von einhegenden Sicherheitsdispositiven begleitet, die kaum Raum lassen zum freien Spiel und zum Entdecken anderer Lebenswelten. Wenn es gerade nicht um eine utopische Rückkehr zur Natur geht, stellt sich die Frage, wofür das Urbane in Kinder- und Jugendmedien heute steht und wozu es einlädt.
Mögliche Themen beziehen sich auf gegenwärtige und historische Aspekte urbanen Lebens –
immer mit Bezug auf Kinder- und Jugendmedien, auch als Gegenstand von Sachliteratur:
- Urbanität in Metropole, Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt
- Widersprüche urbanen Lebens
- Stadt als Konstrukt
- Kulturelle Diversität
- Stadt als Raum von Kindheit und Adoleszenz
- Handlungsraum Stadt und Genre (Urban Fantasy, Krimi, Thriller)
- Stadt als Möglichkeitsraum, als hetero- oder dystoper Raum
- Die Stadt als Ort von Mythen, Legenden und Geschichten
- Natur in der Stadt (Urban Gardening, Bienen, Füchse)
- Symptome der Gentrifizierung
- Stadt als Ort von Protest
- Reisen in die Stadt (Stadtreiseführer für Kinder)
- Geographie der Literatur: ,wirkliche‘ Städte (Berlin, Venedig etc.) in der fiktionalen Literatur
- Stadt-Land-Gegensätze / Stadt-Land-Beziehungen
Die GKJF hofft auf Ihr reges Interesse und bittet um Zusendung von Vortragsangeboten (von maximal 30 Minuten Dauer) bis zum 10.01.2020.
Dem Vorschlag sollte ein kurzer Aufriss des Vortragsthemas beigefügt sein. Bitte beachten Sie bei der Einreichung Ihres Abstracts (von ca. 300 Wörtern) folgende Anforderungen:
Die Abstracts sollen in einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur und ggf. Primärquellen nennen, auf die sich der Vortrag stützt. Damit die Vorträge zu einem Programm im oben beschriebenen Sinn zusammengestellt werden können, sollte sich der geplante Vortrag einem der oben aufgelisteten Schwerpunkte zuordnen lassen.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge per E-Mail an: u.dettmar@em.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: Aussendung CfP)
CfP Jahrbuch GKJF 2020
Thema: TRÄUME
Der vierte Jahrgang des Jahrbuchs der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung widmet sich den historischen wie gegenwärtigen Dimensionen des Traums in Kinder- und Jugendliteratur und -medien. Die Beiträge sollten die vielfältigen Implikationen dieses komplexen Themas sowohl aus theoretischer als auch aus gegenstandsorientierter Perspektive in seinen unterschiedlichen erzählerischen und medialen Realisierungen (Romane, Kurzprosa, Lyrik, Theaterstücke, Bilderbücher, Comics, Graphic Novels, Hörmedien, Filme, Computerspiele) aufgreifen und vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für Kinder- und Jugendkultur diskutieren.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
Narratologie
Psychoanalytische bzw. psychologisch fundierte traumtheoretische Zugänge
Utopie, Dystopie
Phantastik, phantastische Schreib- und Erzählweisen
Nacht, Ästhetik der Nacht
Horror und Angst
Schlaf der Vernunft
Traum als Metapher
Surrealismus
CfP engl.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Die Abstracts (von nicht mehr als 300 Worten) sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung geben, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an: jahrbuch@gkjf.de
Einsendeschluss: 10.10.2019
(Quelle: Aussendung GKJF)
CfP and Conference "Transformation and Continuity"
CfP and Conference The 15th International Child and the Book Conference
"Transformation and Continuity: Political and Cultural Change in Children's Literature from the Past Century to the Present Day"
Date: 27-29 May 2020
Venue: Freie Universität Berlin, Germany
Tying in with political and cultural changes in Germany and Europe, this conference focuses on current discourses on the significance of democratic systems in opposition to authoritarian regimes, to fathom the transformation but also continuities in children’s and young adult literature since the beginning of the 20th century to the present day. In recent years, scholarship on children’s and young adult literature has addressed radical changes occurring in this period. These include the rise of nationalism, the discursive construction of migration, and increased awareness of Othering, resulting, for instance, in racism and discrimination against disability, religion, sexual orientation and gender identity. These broad forces shape the future of young generations, but also resonate with the past, and therefore cannot be seen outside the context of tensions between transformation and historical continuity – as is visible throughout post-war Europe and in the city of Berlin in particular.
Referring to the history of Germany and Europe beginning with the rise of fascism in the early 20th century, this conference focuses on the presence of both historical continuity and radical departures from the past, whether that past is conceived of in political, aesthetic, or pedagogical terms. It will gather international scholars who represent a multitude of disciplinary perspectives. We hope to spark discussions surrounding issues of continuity and transformation, with an emphasis on the political dimensions of these concerns, by inviting papers addressing a wide range of subjects in children’s and young adult literature and media, such as picturebooks, comics, and children’s films.
We invite papers related to the conference theme. Possible areas for investigation include, but are not restricted to:
- transformation and continuity in politics and ideology · discourses of identity and identity politics in children’s literature · past and present in historical narratives
- considerations of children’s publishing policy and censorship
- changing conceptions of the child citizen
- the politics of pedagogy
- trauma and (post)memory (World War II, Holocaust, displacement, migration, exile, etc.)
- transformation and continuity in cold-war children’s literature and media
Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day will reflect academic diversity, and host studies from across different fields of research, academic systems, and cultural backgrounds. We welcome proposals for individual papers as well as panels. We particularly encourage graduate students and other early-career scholars to apply.
Please send an abstract of 300 words and a short biography (100 words) as two attached Word documents to Catalina Zech at: c.zech@fu-berlin.de before October 1, 2019.
Panel proposals may consist of either three or four papers. Panels should consolidate papers with focus on the conference main theme. The panel organizer should invite participants and evaluate each paper in the panel, but the panel as a whole and its individual papers will also be reviewed by external evaluators. For a panel proposal, the panel organizers should submit a short overview statement of the panel theme (300-500 words), a list of participants, and the abstracts of their papers.
Abstracts should include the following information:
a. author(s) with affiliation(s)
b. title and text of proposal
c. selected bibliography with 3-5 academic references
d. five keywords
All abstracts and papers accepted for and presented at the conference must be in English.
Papers will be 20 minutes maximum followed by a 10 minutes discussion.
Deadline for abstract submission: October 1, 2019
Notification of acceptance: November 15, 2019
All submissions are blind reviewed by the members of the Reading Committee.
Scientific Committee:
Farriba Schulz (Freie Universität Berlin)
Ada Bieber (Humboldt-Universität zu Berlin)
Petra Anders (Humboldt-Universität zu Berlin)
Bettina Kümmerling-Meibauer (Eberhard Karls Universität Tübingen)
(Quelle: CfP)
CfP: puppen/dolls like mensch – puppen als künstliche menschen
Der dritte CfP der Zeitschrift denkste: puppe / just a bit of: doll (de:do), ein multidisziplinäres Online-Journal mit Peer-Review für Mensch-Puppen-Diskurse, hat den Themenschwerpunkt „puppen/dolls like mensch – puppen als künstliche menschen“.
Mit dem Fokus auf Puppen als „künstliche Menschen“ greifen wir ein Thema auf, das Menschen seit der Antike begleitet und ihren ‚Verstand‘ und ihre ‚Herzen‘ in Unruhe versetzt. In Mythologien, literarischen Fiktionen und Narrativen, in Werken der bildenden Künste, im Film, in mechanisch-technischen Utopien, in den performativen Künsten, in der Pädagogik und den psychosozialen Bereichen von Psychotherapie und Beratung sowie in all den Lebensfeldern, in denen sich Neugier, Imaginationskraft, Fantasie und Widerstandskraft entfalten, wirft das Motiv der Puppe und ihr Einbezug grundlegende existenzielle Fragen auf: Wer und was ist der Mensch? Mit der atemberaubenden Entwicklung von Informatik und Robotik in den letzten Jahrzehnten und der aktuellen Forschung und Anwendungspraxis im Bereich der künstlichen Intelligenz werden dabei einerseits völlig neue Antworten auf die uralten Fragen gesucht und gegeben, die andererseits aber auch in die Jahrtausende alten Traditionslinien eingebunden werden können und sie weiterschreiben.
Der Call richtet sich an unterschiedlichste disziplinäre Theorie-, Forschungs- und Praxisfelder. Es geht darum, die Idee der Puppen als künstliche Menschen in der Vielzahl ihrer literarischen, künstlerisch-kulturellen, materiell-technischen, medialen, psychologisch-pädagogischen Varianten und Erscheinungsformen auszuleuchten. Dabei sollten sich nicht nur geistes- und kulturwissenschaftliche Disziplinen angesprochen fühlen, sondern auch die Bereiche Design, Technik, Robotik bzw. Technik-Mensch-Interaktionen. Denn mit dem hier angesprochenen Themenschwerpunkt wird angestrebt, an den Schnittstellen unterschiedlichster Disziplinen neue transdisziplinäre Diskurse zu initiieren.
Die Beiträge sollen nicht mehr als 30.000 Zeichen umfassen. Das angesprochene Themenspektrum ergibt sich aus den oben genannten Überlegungen. Es sollte in jedem Fall auf interdisziplinäre Verständlichkeit geachtet werden. Die Texte können auf Deutsch oder Englisch als e-Datei beim Editorial Team (Prof. Dr. Insa Fooken, fooken@psychologie.uni-siegen.de und/oder Dr. Jana Mikota, mikota@germanistik.uni-siegen.de) eingereicht werden. Angebote für einen Beitrag erbitten wir mit einer knappen Skizze (ca. 3.500 Zeichen) und einer Kurz-Vita bis 31. August 2019.
Rückmeldungen zur Aufforderung, einen Beitrag einzureichen, erfolgen bis Mitte September 2019. Das endgültige Manuskript muss spätestens Ende Dezember 2019 vorliegen.
(Quelle: Aussendung)
CfP "52. Ausgabe libri liberorum"
Libri liberorum, die Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteraturforschung, erschien kürzlich in der 50. Ausgabe. Libri liberorum wurde im Jahr 2000 als Mitteilungsblatt der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF) gegründet, 2010 in eine wissenschaftliche und 2016 in eine peer reviewte Zeitschrift umgewandelt. Ab der 51. Ausgabe erscheint sie open access.
Das Ziel der Zeitschrift ist die Erforschung der historischen und aktuellen Kinder- und Jugendliteratur mit Schwerpunkt auf Themen über und aus Österreich. Sie dient als Kommunikationsplattform und als Informationsforum für ExpertInnen und Interessierte im In- und Ausland. Neben wissenschaftlichen Fachbeiträgen werden auch Projektberichte, Miszellen und Rezensionen angenommen.
Nach einigen themenspezifischen Heften (siehe auch hier) möchten wir das Heft 52 thematisch für spannende Forschungsergebnisse im Bereich historischer oder zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur und -medien öffnen und freuen uns über Ihre Abstracts (ca. 300 Wörter) und Kurzbiografien (ca. 100 Wörter) auf Deutsch oder Englisch bis zum 30. Juni 2019 an: oegkjlf@univie.ac.at
Call for articles: „Das Runde muss ins Eckige“: Fußball in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
Call for articles „Das Runde muss ins Eckige“: Fußball in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
Im Sommer 2022 findet im Emirat Katar die 22. FIFA-Weltmeisterschaft statt. Aus diesem Anlass wollen die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und die Schwabenakademie Irsee den Standort des Fußballs in deutschen kinder- und jugendliterarischen Veröffentlichungen bestimmen.
Ein Hauptaugenmerk wird auf den Kinder- und Jugendbuchmarkt seit der Weimarer Republik gerichtet, mit Schwerpunktsetzung auf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart: Sowohl einschlägi-ge Einzeltitel als auch serielle Produktionen und deren historische Entstehungskontexte, narrative Erzähl-strategien und gesellschaftspolitische Einflüsse sollen zur Sprache kommen, darüber hinaus spezifische Entwicklungen in den jeweiligen Genres sowie die in ihnen vertretenen Werte und Normen. Weiterhin ist der Frage nachzugehen, wie die Kulturgeschichte des Fußballsports in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur reflektiert und verarbeitet wird. Hierbei kommen alle Gattungen und Genres deutschsprachiger Veröffentlichungen für junge Leserinnen und Leser (Lyrik, Kurzprosa, Roman, Bilderbuch, Comic, Graphic Novel, Sammelbände, Zeitungen) sowie mediale Darstellungsformen mit Blick auf weiterführende Medienverbundsysteme (Film, Fernsehen, Com-puterspiel, Apps etc.) in Betracht.
Abstracts
Die Veranstalter erbitten Abstracts von maximal 500 Wörtern. Diese sollen eine kurze inhaltliche Zusam-menfassung bieten, darüber hinaus eine Kurzvita, Angaben zur Fragestellung, zu den historischen Kontex-ten und gesellschaftspolitischen Aspekten sowie zu der herangezogenen Primärliteratur.
Die Abstracts sind bis 1.4.2019 zu senden an praesidium@akademie-kjl.de
(Quelle: Pressemitteilung)
CfP und Tagung: 32. Jahrestagung der GKJF
Thema: Kulturelles Gedächtnis reloaded? (Re-)Inszenierungen von Erinnerung in Kinder- und Jugendmedien
Tagungsort: Arbeitnehmer-Zentrum, Königswinter
Termin: 30.5. bis 1.6. 2019
„Verinnerlichte Vergangenheit findet ihre Form in der Erzählung“. (Jan Assmann)
Der Blick in die Vergangenheit erfreut sich nicht nur auf dem Buchmarkt einer bemerkenswerten Popularität, sondern ist in allen Medien stark präsent: Das Spektrum reicht von so unterschiedlichen Formaten wie den (umstrittenen) Geschichtsdokumentation Guido Knopps über Fernsehserien wie Babylon Berlin, über historische Romane wie Hertha Müllers Atemschaukel oder Daniel Kehlmanns Tyll bis hin zu Computerspielen wie Through the Darkest Time. Die gesellschaftliche Bedeutung der – im Unterschied zum Gedächtnis – eher präsentischen Erinnerung zeigt sich zudem symbolisch in der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an die Erinnerungsforscher Aleida und Jan Assmann. Dabei belegt schon das Eingangszitat Assmanns die Untrennbarkeit von Narration und Erinnerung für das kulturelle Gedächtnis, wobei auch in der medialen Re-Inszenierung von Geschichte in Geschichten der klassische Aristotelische Widerspruch von ‚objektiver‘ Geschichtswissenschaft und Dichtung zwischen den Polen Referenzialität und einem neuen Interesse am vermeintlich Authentischen sowie der Fiktionalisierung von Fakten zum Tragen kommt.
Dieser Widerspruch gilt auch bzw. in besonderem Maße für die geschichtserzählenden Kinder- und Jugendmedien in ihrem spezifischen Spannungsfeld von ästhetischer und (latenter) historischer (pädagogischer oder ideologischer) Horizontbildung und -erweiterung, die stetig neu kontextualisiert, revidiert und aktualisiert werden, aber auch und in weiteren Dimensionen für das (auto-)biographische Erzählen. Daher setzt es sich die 32. Tagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) zum Ziel, diesen Veränderungen der ästhetischen Verfahren und der Erinnerungsgegenstände nachzuspüren. Dabei sollen neben den epischen kinder- und jugendliterarischen Traditionsmedien – erzählende Literatur, historische und zeitgeschichtliche Romane, (autofiktionale) Biographien – sowie Drama und Lyrik auch Bilderbücher, Comics, Filme und Serien oder Computerspiele in den Blick genommen werden.
Mögliche Themen – immer mit Bezug auf die Kinder- und Jugendmedienforschung – sind:
Positionen der Forschung
Medien und Formen der Erinnerung
national/international/transnational tradierte und neue Gegenstände geschichtserzählender Kinder- und Jugendmedien (in diachroner und synchroner Perspektive) wie bspw. Kriege, Revolution, Holocaust, Flucht und Vertreibung, Staatengründungen, Mauerbau, Mauerfall und Deutsche Einheit, Europäische Einigung, Globalisierung
(inter-)generationelle Kommunikation / generationelle Ordnung
Progressionen/Regressionen dominanter Wertungsmuster und ethische Dimensionen von Geschichtsfiktionen
Narrative und ästhetische Strategien / Kontinuitäten, Veränderungen, Entwicklungen
Genrehybridisierungen/Gattungstransgressionen (Zeitreiseromane, historische Kriminalromane etc.)
Unzuverlässigkeit der Erinnerung bzw. (Grenzen der) Erfindung von Erinnerung / Zeitzeugenschaft
Autobiographisches und biographisches Schreiben
Kindheit und Jugend erinnern
Deutungshoheit, Kanonisierung, Gegengedächtnis in unterschiedlichen Gesellschaftsformen
Die GKJF hofft auf Ihr reges Interesse und bittet um Zusendung von Vortragsangeboten (von maximal 30 Minuten Dauer) bis zum 11.01.2019.
Ihrem Vorschlag sollte ein kurzer Aufriss des Vortragsthemas beigefügt sein.
(Quelle: Aussendung GKJF)
CfP: Vergessene österreichische Kinder- und Jugendliteratur
Call for Papers:
Vergessene österreichische Kinder- und Jugendliteratur
Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (ÖG-KJLF) plant im Rahmen ihrer Schriftenreihe „Kinderliteraturforschung in Österreich“ eine Fortsetzung des Bandes „Kinderliteratur als kulturelles Gedächtnis. Beiträge zur historischen Schulbuch-, Kinder- und Jugendliteraturforschung 1“
Der Fokus dieses Bandes liegt auf jener österreichischen Literatur für Kinder, bzw. Jugendliche, die in Vergessenheit geraten ist. Die Gründe dafür können sehr vielfältig sein und reichen von wirtschaftspolitischen Gegebenheiten – so werden auch beispielsweise Werke hoher Qualität unter ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht erneut aufgelegt – über Ausgrenzung und Verdrängung von Autorinnen und Autoren ins Ausland, wie etwa in der Zeit des Nationalsozialismus, bis zu Werken, deren Urheberinnen und Urheber unbekannt blieben.
Abstracts können u.a. zu folgenden Themen eingereicht werden:
- Kinder- und Jugendliteratur – der unberechenbare Markt
- Werke für Kinder und /oder Jugendliche als Teil der österreichischen Kulturgeschichte
- Verbotene, verdrängte und schließlich vergessene KJL
- Das Verlagswesen und sein Anteil an der Kurz-, bzw. Langlebigkeit von Kinder- und Jugendliteratur
- Beispiele an zu Unrecht vergessener Literatur für Kinder und/oder Jugendliche
- Halten Übersetzungen die Kinder-/Jugendliteratur am Leben?
- Über Zufallsfunde in Nachlässen – über jene Manuskripte, die nie gedruckt wurden
- Die Rezeption von Kinder-/Jugendliteratur im Ausland - ein Garant für die Langlebigkeit der Werke?
- Das Erinnern an Illustration - inwieweit tragen Bilder in Kinder-/Jugendliteratur zum Verbleib im kulturellen Gedächtnis bei?
- Die Erhaltung der Provenienz von Kinderbuchbeständen als Teil des kulturellen Gedächtnisses.
- Wie wirkt sich die Digitalisierung von Kinder- und Jugendliteratur auf die aktuelle Rezeption von historischer Kinder- und Jugendliteratur aus?
Wir freuen uns auf Ihr Abstract (ca. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen) und max. 300 Zeichen Kurzbiografie bis zum 15. Dezember 2018.
Bei Annahme des Abstracts erwarten wir Ihren Beitrag (30 000 bis 50 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Literaturverzeichnisse und Fußnoten)) bis zum 31. Mai 2019.
Bitte schicken Sie Ihr Abstract und Ihre Kurzbiografie an: oegkjlf@univie.ac.at
Das Herausgeberteam (alle Universität Wien)
Mag. Dr. Susanne Blumesberger, MSc
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wynfrid Kriegleder
Univ.-Doz. Mag. Dr. Ernst Seibert
CfP und Tagung "The 14th International Child and the Book Conference: Beyond the Canon (of Children’s Literature)"
The Conference raises questions following recent research on the canon of children's literature, focusing on exclusion from the canon, i.e. on literature and related phenomena and forms of expression which remain beyond the canon.
Taking these issues as starting points, the Conference will focus on the following general topics:
- Children’s literature and the literary canon
- Forming the canon of children’s literature: contexts and influences
- Inside and outside the canon: reasons for inclusion/exclusion and forgotten titles
- The canon of children's literature vs. the canon of young adult literature
- Translation and publishing practices in relation to the canon(s) of children’s and young adult literature
- The international canon and the perception of own and other cultures in the national canons of children’s literature
- Canonical illustrations and the (re-)interpretations of children’s classics
- Reading practices and the canon of children’s literature
- Adaptations of the canonical titles of children’s and young adult literature
- The canon of children’s culture: literature, arts, multimodality, new media…
They invite proposals for papers to be presented in English or Croatian. The presented papers will be 15 minutes maximum, followed by 5 min discussion time.
For a paper proposal, please submit an abstract of 200-500 words and up to 5 keywords. The submission deadline is 15 November 2018. All proposals will be reviewed, and the authors of the proposals will receive notification of acceptance by 15 January 2019. To submit paper proposals or panel proposals, please fill in the interactive submission form at the Conference website.
Further information you get here.
(Quelle: Aussendung CBC)
CfP "Fachzeitschrift für KJL-Literatur"
CfP - Fachzeitschrift für KJL-Literatur
Fragestellung aus Sicht der aktuellen KJL-Forschung:
Wie spiegelt sich der Körper in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart?
Die Beiträge sollten die Darstellungen des Körpers in der internationalen Kinder- und Jugendliteratur, in Filmen und Serien für Kinder und Jugendliche untersuchen sowie die Werte und das Wissen, welche diese dem Leser/Zuschauer vermitteln.
Die Universität Besançon-Franche-Comté bzw. deren Forschungszentrum CRIT (EA 3224, Axe 2) möchte im Januar 2019 Beiträge/Aufsätze/Studien zu dieser Fragestellung publizieren und Diskussionen darüber anregen, wie der Körper in der internationalen KJL beschrieben bzw. verschwiegen wird. Gibt es im Laufe der Zeit eine Entwicklung in der Repräsentation des Körpers von Kindern und Jugendlichen, die über die bloße Dokumentation stereotyper Repräsentationen hinausgehen?
Folgende Aspekte können in den Beiträgen/Aufsätzen/Studien aufgegriffen werden:
- das Bild des eigenen Körpers (Identität, Geschlecht)
- der Blick des Anderen auf den Körper (Objekt / Subjekt, Anziehung / Abstoßung)
- der tabuisierte, verschleierte Körper / der nackte, enthüllte Körper
- der kranke, missgebildete, missbrauchte Körper / der gesunde, athletische, leistungsfähige Körper
- das Körperbild in Erzählungen, Comicstrips, Manga, Filmen, Serien, usw.)
- der Körper in der Fantasy, Science-Fiction (Cyborgs, Spektralkörper, Geister, Vampire, usw.)
- Welcher Körper für welchen Heroismus?
- Die Verbalisierung der Körperlichkeit
Es wird gebeten, der Redaktion themenbezogene Beiträge/Aufsätze/Studie in deutscher oder englischer Sprache (ca. 45000-55000 Zeichen; WORD-Datei) sowie Angaben zu Ihren Forschungsgebieten und Ihrer institutionellen Einbettung bis zum 15.10.2018 an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: r.atzenhoffer@unistra.fr
Wünschenswert wären auch Angaben zu eigenen Publikationen zum Themengebiet KJL. Die eingesandten Beiträge werden begutachtet. Eine Benachrichtigung über die Annahme des Beitrags erfolgt bis zum 1. November 2018.
(Quelle: CfP)
CfP "denkste: puppe (de:do)"
Call for Paper
denkste: puppe (de:do), multidisziplinäre Online-Zeitschrift für Mensch-Puppen-Diskurse
just a bit of: doll (de:do), a multidisciplinary online-journal for human-doll discourses
Themenschwerpunkt des zweiten Hefts (Ausgabe 2/2018)/ Topic Focus of the Second Issue:
Puppen als Miniaturen – mehr als klein / Dolls/Puppets as Miniatures – More than Small
Das zweite Heft der Zeitschrift widmet sich dem Thema Puppen als Miniaturen – mehr als klein. Puppen und ihre Umwelten (z.B. Puppenhäuser) sind in diesem Zusammenhang ‚mehr‘ als nur verkleinerte Varianten oder Repliken von Menschen und ihren Lebenswelten. Sie 2 generieren Bilder und Narrative, die einen eigenen Zauber entfalten können und in ihrer Funktion und Wirkung changieren: zwischen Beispielhaftigkeit, Trivialität, Außergewöhnlichem, Exklusivität, Verdichtung, ‚Downsizing‘, Kindchenschema, magischer Aufladung etc. Dabei soll es auch um mediale Erscheinungsformen der Puppe als Miniatur gehen, stehen doch aus etymologischer Perspektive Bild und Schrift Pate bei der Geburt der Miniatur: Bei der ‚miniatura‘ ging es zunächst nicht um den ‚kleineren Maßstab eines Größeren‘, sondern um das Malen mit Zinnoberrot (miniare); darum, die Initialen in Manuskripten rot zu gestalten, um sie in der weiteren Bearbeitung durch in die Buchstaben gemalte kleine Bilder ersetzen zu können (siehe Kluge/Seebold).
Konzipiert man Puppen in diesem Sinne als Miniaturen, kommen wechselseitige Spannungsverhältnisse ins Spiel: zwischen ‚klein‘ und ‚groß, ‚Sichtbarem‘ und ‚Verstecktem‘, ‚Mimetik‘ und ‚Poetik‘, ‚real‘ und ‚fiktiv‘. Puppen als Miniaturen sind hybride Objekte, aufgeladen mit vielerlei Symbolik und Bedeutungsüberschuss, die ein Referenzsystem darstellen des Allerkleinsten im Kleinsten im Kleinen beziehungsweise der Puppe in der Puppe in der Puppe. Dabei gelten Miniaturen und Miniaturwelten gleichzeitig auch als ein ‚Fundort der Größe‘ (Bachelard), sie ermöglichen wie in einem Brennglas den Blick auf das Ganze, auf Hintergründiges jenseits der Oberfläche und auf die Erkenntnis von inneren Zusammenhängen. Das gilt für Miniaturen und ihre Narrative in vielerlei Feldern und Disziplinen – in der Literatur, in den (bildenden) Künsten, in der Archäologie, in der Fotografie, im Film, in der Musik, im Figuren- und Objekt-Theater, im Design und nicht zuletzt in den konkreten Nachbildungen und ‚Nachstellungen‘ der realen Außenwelten. So geht es auch um die Ordnungen der kleinen, miniaturisierten Dinge in den Puppenwelten, den großen und kleinen Puppenhäusern, den Hausaltären, den persönlichen Objekt-Arrangements, den musealen Präsentationen, Sammlungen, Spielzeugen, den Modellen von Mensch-Technik-Zusammenhängen etc. bis hin zu Puppenstubenmorden als Anschauungsmaterial für Tatorte in der Rechtsmedizin und vor
Gericht.
Der Call richtet sich an verschiedenste disziplinäre Forschungs- und Praxisfelder. Es geht darum, die Idee der Puppe als Miniatur in der Vielzahl ihrer medialen und historischen Varianten neu auszuleuchten, ihrer Verortung in aktuellen kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Diskursen nachzugehen und sie in ihrem Potenzial neu zu entdecken.
Die Beiträge sollen nicht mehr als 30.000 Zeichen umfassen. Das angesprochene Themenspektrum ergibt sich aus den oben genannten Überlegungen. Die Texte können auf Deutsch oder Englisch als e-Datei beim Editorial Team eingereicht werden. Angebote für einen Beitrag mit einer knappen Skizze (ca. 3.500 Zeichen) bis 7. September 2018. Rückmeldungen zur Aufforderung, einen Beitrag einzureichen, erfolgen bis Ende September 2018. Die Manuskripte sollen spätestens Ende Dezember 2018 vorliegen.
CfP
Weitere Informationen finden Sie hier.
(Quelle: CfP)
CfP "Fachzeitschrift für KJL-Literatur"
CfP - Fachzeitschrift für KJL-Literatur
Fragestellung aus Sicht der aktuellen KJL-Forschung:
Wie spiegelt sich der Körper in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart?
Die Beiträge sollten die Darstellungen des Körpers in der internationalen Kinder- und Jugendliteratur, in Filmen und Serien für Kinder und Jugendliche untersuchen sowie die Werte und das Wissen, welche diese dem Leser/Zuschauer vermitteln.
Die Universität Besançon-Franche-Comté bzw. deren Forschungszentrum CRIT (EA 3224, Axe 2) möchte im Januar 2019 Beiträge/Aufsätze/Studien zu dieser Fragestellung publizieren und Diskussionen darüber anregen, wie der Körper in der internationalen KJL beschrieben bzw. verschwiegen wird. Gibt es im Laufe der Zeit eine Entwicklung in der Repräsentation des Körpers von Kindern und Jugendlichen, die über die bloße Dokumentation stereotyper Repräsentationen hinausgehen?
Folgende Aspekte können in den Beiträgen/Aufsätzen/Studien aufgegriffen werden:
- das Bild des eigenen Körpers (Identität, Geschlecht)
- der Blick des Anderen auf den Körper (Objekt / Subjekt, Anziehung / Abstoßung)
- der tabuisierte, verschleierte Körper / der nackte, enthüllte Körper
- der kranke, missgebildete, missbrauchte Körper / der gesunde, athletische, leistungsfähige Körper
- das Körperbild in Erzählungen, Comicstrips, Manga, Filmen, Serien, usw.)
- der Körper in der Fantasy, Science-Fiction (Cyborgs, Spektralkörper, Geister, Vampire, usw.)
- Welcher Körper für welchen Heroismus?
- Die Verbalisierung der Körperlichkeit
Es wird gebeten, der Redaktion themenbezogene Beiträge/Aufsätze/Studie in deutscher oder englischer Sprache (ca. 45000-55000 Zeichen; WORD-Datei) sowie Angaben zu Ihren Forschungsgebieten und Ihrer institutionellen Einbettung bis zum 15.10.2018 an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: r.atzenhoffer@unistra.fr
Wünschenswert wären auch Angaben zu eigenen Publikationen zum Themengebiet KJL. Die eingesandten Beiträge werden begutachtet. Eine Benachrichtigung über die Annahme des Beitrags erfolgt bis zum 1. November 2018.
(Quelle: CfP)
CfP "Jahrbuch der GKJF"
Call for Papers – Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung 2019
Thema: Fakt, Fake und Fiktion
Die Beiträge für den dritten Jahrgang des Jahrbuchs für Kinder- und Jugendmedienforschung sollen die vielfältigen Implikationen des Themenkomplexes „Fakt, Fake und Fiktion“ sowohl aus theoretischer wie gegenstandsorientierter Perspektive in den Blick nehmen und diesen in seinen unterschiedlichen medialen Gestaltungsformen (Erzählungen, Bilderbücher, Comics, Graphic Novels, Filme, Fernsehen, Computerspielen und Apps) aufgreifen.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
- Grenze zwischen Roman und Sachbuch, hybride Formen dazwischen
- Grenze zwischen Spielfilm und Dokumentation, hybride Formen dazwischen
- Motive: Täuschung; Lüge; Maskerade; Verkehrte Welt
- Figur des Hochstaplers im weiteren Sinn
- Gattungen: Lügengeschichte; Lügenmärchen; Münchhausiade; Schelmenroman; Schlaraffenland-Dichtung; Nemoliteratur; alternate history, scripted reality
- unzuverlässiges Erzählen
- Erzählen mit kontrapunktischen Bild-Schrifttext-Kombinationen
- Pseudoübersetzungen im Spannungsfeld zwischen Fake und Fiktion
- AutorInnen- und HerausgeberInnenfiktionen
- …
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder- und jugendliterarischen/-medialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch hier bitten wir um entsprechende Vorschläge.
Themenbezogene bzw. offene Beiträge sind bis zum 10.10.2018 in Form eines Abstracts von nicht mehr als 300 Wörtern einzusenden.
Die Abstracts sollten außer einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung Angaben über die Fragestellung machen, den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur nennen, auf die sich der Beitrag stützt.
Die Beiträge selbst sollten einen Umfang von 40.000 Zeichen (incl. Fußnoten und Literaturverzeichnis) nicht überschreiten und den HerausgeberInnen spätestens bis zum 01.03.2019 als Word-Dokument vorliegen.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an:
g.glasenapp@uni-koeln.de
caroline.roeder@t-online.de
michael.staiger@uni-koeln.de
osullivan@uni.leuphana.de
ingrid.tomkowiak@uzh.ch
(Quelle: CfP)
Aufruf zu Beiträgen: Kinder- und Jugendliteratur im universitären DAF-Unterricht
Der geplante Sammelband soll der Frage nachgehen, inwiefern Kinder- und Jugendbücher für den universitären Deutschunterricht didaktisches Potenzial bieten. Dem Rahmen des DAAD-Fachseminars geschuldet beziehen sich die Beiträge insbesondere auf den DAF-Unterricht in Frankreich, können aber auch in jeweils spezifischer Perspektive auf den DAF-Unterricht in anderen Ländern oder Deutschland eingehen.
Nicht nur Literaturkurse für Germanisten können einen angemessenen Rahmen für den Einsatz von Kinder- und Jugendbüchern bieten, auch in begleitenden Deutschkursen (Politikwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften) beziehungsweise in LEA (Langues étrangères appliquées)-Studiengängen bietet sich die Arbeit mit dieser Literatur an. Im französischen Kontext ist die Auseinandersetzung mit Kinder- und Jugendbüchern darüber hinaus insbesondere für Unterrichtende in der Lehrerausbildung am ESPE (École supérieure du professorat et de l’éducation) interessant, sind doch angehende Deutschlehrer dazu angehalten den französischen Lehrplänen entsprechend mit deutschen Kinder- und Jugendbüchern zu arbeiten.
Als Anhaltspunkte für die Beiträge können unter anderem folgende allgemeine Kategorien genannt werden:
- Nutzen der „sprachlichen Einfachheit“, der kurzen Formen, des Text-Bild-Bezugs von Kinder- und Jugendliteratur im DAF-Sprachunterricht (z.B. Ansätze für den Grammatikunterricht, für Textproduktionen, für den Linguistikunterricht)
- Sensibilisierung Studierender für die Frage nach dem Adressaten ausgewählter Kinder- und Jugendliteratur sowie für die Arbeit des Verlags- und Buchhandels in Deutschland
- Nutzen von Kinder- und Jugendliteratur im universitären Geschichts- und Landeskundeunterricht
- Auseinandersetzung mit der Übersetzung/Adaptation von Kinder- und Jugendliteratur in version- und thème-Kursen in Abgrenzung zur Erwachsenenliteratur
- Neue didaktische Ansätze für die Bearbeitung von Kinder- und Jugendliteratur in der Deutschlehrerausbildung
Vorschläge für Beiträge in deutscher oder französischer Sprache (Titel und Abstract von max. 1500 Zeichen mit kurzer Bio-Bibliographie) können bis spätestens 15.05.2018 an Ramona Herz-Gazeau (ramona.gazeau@unicaen.fr) und Katrin Link (katrin.link@univ-rouen.fr) gesendet werden. Abgabefrist für die Beiträge ist der 15.08.2018. Die Veröffentlichung des Bandes ist im Frühjahr 2019 geplant.
CfP und Tagung "Postmoderne Schreibweisen, künstlerische Überformung und literarische Tradition"
Call for Papers und Tagung:
Postmoderne Schreibweisen, künstlerische Überformung und literarische Tradition: Studien zum kinderliterarischen Werk Tonke Dragts und seinen medialen Adaptionen
Termin: 30. September bis 2. Oktober 2019
Ort: Siegen
Tonke Dragt ist seit über 50 Jahren eine der beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der Niederlande. In Deutschland haben sich ihre beiden bekanntesten Werke, Der Brief für den König und Das Geheimnis des siebten Weges zu populären Longsellern entwickelt. Zu diesen und einigen anderen Werken liegen vielfältige mediale Adaptionen – vom Film über Hörbücher bis zum Computerlernspiel – vor. Aktuell plant Netflix eine Serie Der Brief für den König. Als Schullektüre sind Dragts Romane präsent.
Von besonderem Interesse für die KJL-Forschung sind neben literaturwissenschaftlichen Fragestellungen auch ihre Illustrationen und Collagen zu fremden und eigenen Werken.
Mögliche Themen für Vorträge sind:
- biographische Aspekte
- die Verortung von Dragts Schaffen in der Entwicklung der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur
- Tonke Dragts Kinder- und Jugendbücher und ihre Genres (Abenteuer, Märchen, Phantastik, Science Fiction)
- Literaturwissenschaftliche Analysen und Einordnungen zu Texten Tonke Dragts (z.B. aus literaturökologischer, postkolonialistischer, komparatistischer, stoff- und motivgeschichtlicher oder translationstheoretischer Perspektive) interdisziplinäre Untersuchungen zu Dragts Illustrationen eigener und fremder Werke
- mediale Adaptionen (Film, Fernsehen, Hörbuch, Computerspiel) der Werke Dragts
- Vorstellungen schulpraktischer Umsetzungen zu einzelnen Werken
- Fragen nach Differenz zwischen Popularität und Kanonisierung
Angebote für einen Vortrag zur Tagung erbittet das Editorial Team mit einer knappen Skizze (ca. 300 Wörter) sowie einem akademischem Kurz-CV bis 30. November 2018. Die Vorschläge sollen an das Editorial Team geschickt werden:
Prof. Helma Lierop-Debrauwer, Universität Tilburg, NL (email: H.vanLierop@uvt.nl)
Dr. Jana Mikota, Universität Siegen (email: Mikota@germanistik.uni-siegen.de)
Erik Dietrich, Universität Siegen (email: erik-dietrich@gmx.de)
Organisiert wird die Tagung von Prof. Dr. Helma Lierop-Debrauwer (Universität Tilburg, NL), Dr. Jana Mikota und Erik Dietrich (Universität Siegen).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem CfP.
(Quelle: CfP)
CFP: GKJF - Jahrbuch für Kinder- und Jugendmedienforschung 2017
„Flucht und Migration sind zu derzeit unübersehbaren Kennzeichen globalisierter Lebenswelten und -wirklichkeiten geworden. Nicht nur als marktorientierte Reaktion auf diese Entwicklungen beschäftigen sich kinder- und jugendliterarische Texte und Medien in vielfältiger Form mit dieser Thematik. Aus diachroner Perspektive betrachtet bilden Flucht und Migration allerdings in ihren vielfältigen Erscheinungsformen eine zentrale, wiederkehrende und damit zeit- und kulturübergreifende Konstante in der Geschichte der Menschheit.
Mögliche Themen, Aspekte, Zugänge und Schwerpunkte, jeweils mit Bezug auf Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien, wären:
- Dominante Narrative / Stereotype, Figuren und Bilder
- Globalisierung / Transkulturalität
- Alteritätsvorstellungen
- Relevanz von Flucht, Migration, Auswanderung für die Gegenwarts- und Erinnerungskultur
- Imagologie
- Postkolonialismus
- Differenztheorie
Über das Schwerpunktthema hinaus sind zudem bis zu drei offene Beiträge zu kinder- und jugendmedialen Fragestellungen aus historischer wie theoretischer Perspektive erwünscht; auch hier bittet die GKJF um entsprechende Vorschläge."
Einsendeschluss ist der 15.09.2016.
Weitere Informationen zum CFP finden Sie hier.
CFP: 30. Jahrestagung der GKJF in Königswinter
CFP für die 30. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder und Jugendliteraturforschung (25. - 27. Mai 2017 in Königswinter)
zum Thema: "an Schnittstellen. Aktuelle Positionen und Perspektiven der Kinder- und Jugendmedienforschung"
Im nächsten Jahr feiert die Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF) ihr dreißigjähriges Bestehen – eine Erfolgsgeschichte, die zur Retrospektive wie zur Standortbestimmung Anlass gibt. In diesem Sinn soll die Tagung vor allem genutzt werden, um grundsätzliche Fragen der Kinder- und Jugendliteratur- und -medienforschung und ihrer Perspektiven zu diskutieren: sie in der Landschaft der Fächerdisziplinen zu verorten, unterschiedliche Theorieansätze zu erproben und ihre Beiträge zur literaturwissenschaftliche/n Kulturwissenschaft bzw. kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft zu bestimmen. Grundlegende, theoriegeleitete und methodenreflektierte Vorträge stehen im Mittelpunkt; an ihnen sollen analytische Zugänge durchgespielt werden. Dabei geht es zum einen darum, den Standort von Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien (als Handlungs- und Symbolsystem) im kulturellen Archiv auszuloten; zum anderen bzw. vor diesem Hintergrund sollen Ziele gegenwärtiger Forschung diskutiert, hinterfragt sowie Aufgaben und Perspektiven zukünftiger Forschung entwickelt werden. Sinnvoll wären aus Sicht der Kinder- und Jugendliteratur- und -medienforschung perspektivierte Überlegungen zu
- Desiderata und Blickwinkel historischer KJL-Forschung
- Imagologie
- Diskursanalyse / New Historicism
- Erinnerung, Gedächtnis
- Narratologie
- Autorschaft
- Materialität
- Medialität, Intermedialität, Transmedialität
- Topographie und Raum
- Differenztheorie; Diversität, Intersektionalität, Transkulturalität
Die Beiträge sollen theoretisch angelegt sein, d.h. nicht spezielle Forschungsgegenstände beschreiben. Willkommen sind aber sehr wohl Beiträge, die einen Zugang exemplarisch an konkretem Untersuchungsmaterial und in enger theoretischer Anbindung verhandeln. Es wird darauf hingewiesen, dass die ansonsten auf den Tagungen der GKJF übliche Praxis, nur alle zwei Jahre vorzutragen, ausgesetzt wird.
Als Key Note Speaker konnten gewonnen werden: Vanessa Joosen, Monika Schmitz-Emans, Andrea Weinmann und Lies Wesseling.
Die GKJF hofft auf reges Interesse und bittet um Zusendung von Vortragsangeboten (von maximal 30 Minuten Dauer) bis zum 10.01.2017.
Ihrem Vorschlag sollte ein kurzer Aufriss des Vortragsthemas beigefügt sein.
Bitte beachten Sie bei der Einreichung Ihrer Abstracts (von ca. 300 Wörtern) folgende Anforderungen:
Die Abstracts sollen in einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung den Bezug zu theoretischen Positionen herstellen sowie die Literatur und ggf. Primärquellen nennen, auf die sich der Vortrag stützt. Damit die Vorträge zu einem Programm im oben beschriebenen Sinn zusammengestellt werden können, sollte sich der geplante Vortrag einem der oben aufgelisteten Schwerpunkte zuordnen lassen.
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge per E-Mail an: u.dettmar@em.uni-frankfurt.de
(Quelle: http://www.gkjf.de/)
CFP: libri liberorum Heft 49
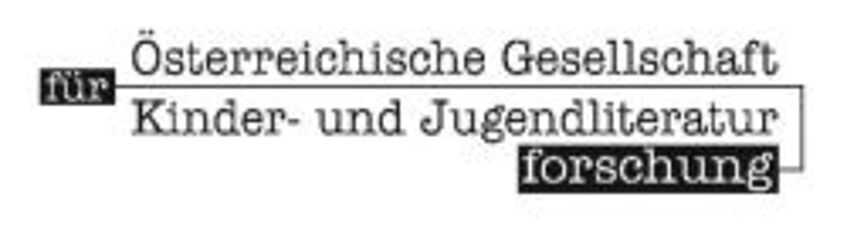
CFP: libri liberorum Heft 49
libri liberorum Heft 49, Frühjahr 2017
"Von der Phantastik zur Neophantastik" (Arno Rußegger, Andreas Peterjan)
Gegenstand von libri liberorum Heft 49 ist der Versuch, sich einem der wesentlichsten Trends im Rahmen der jüngeren Kinder- und Jugendliteratur zu widmen, der Neophantastik. In Abgrenzung zur herkömmlichen „Zwei-Welten-Fantasy“ (Hans-Heino Ewers), mit deren Konzepten die massiven Umbrüche in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen seit 2000 nur mehr bedingt zu erfassen sind, sollen alternative ästhetische Verfahren und Erzählmuster erörtert werden, die in letzter Zeit verstärkt zur Anwendung gekommen sind.
Um ein paar Beispiele für Fragen, die sich daraus ergeben, anzuführen:
- Kommt medial erzeugten Elementen und Figuren heute bereits ein autonomer Charakter zu?
- Werden mittlerweile Medienerzeugnisse als so real wahrgenommen, dass zwischen Tatsachen und Fiktionen nicht mehr unterschieden werden kann?
- Welche Rolle spielt die Sprache, wenn der ontologische Status der Wirklichkeit nicht mehr ohne Weiteres zu klären ist (vgl. Nora Schmidt)?
- Wie verfährt die Kinder- und Jugendliteratur mit Intertextualität und Intermedialität, wie mit metafiktionalen Darstellungsweisen, in denen die Medialität von Literatur, Film und Internet verhandelt wird?
Deutlich wird, dass phantastische Elemente nicht nur als Spiegelbild gesellschaftlicher Ängste und Traumata fungieren, sondern als Sinnbild für Entwicklungsmöglichkeiten und Hoffnungen. Die Grenzen des Menschlichen, kulturelle Differenzen und Genderidentitäten werden neu ausgelotet.
Weitere Schwerpunktsetzungen und thematische Bezüge sind durchaus möglich und erwünscht.
Bei Interesse, einen Beitrag zu einem konkreten Thema in der Zeitschrift libri liberorum zu veröffentlichen, bitten wir Sie, die folgenden Termine einzuhalten:
- Deadline für die Einreichung der Abstracts (max. 300 Wörter) ist der 15. Oktober 2016
- Termin für die Abgabe der Artikel als Word-Dokument ist der 15. Jänner 2017
- Bitte senden Sie Ihre Abstracts und eine Kurzbiographie mit dem Betreff "lili 49" per E-Mail sowohl an
arno.russegger@aau.at als auch an
oegkjlf@univie.ac.at
Weitere Informationen zum CfP finden Sie hier.
CFP: "Berlin: Bilder einer Metropole in erzählenden Medien für Kinder und Jugendliche“ (Sammelband)
Mögliche Fragestellungen zur Metropole Berlin können sein:
- Berlin im Bilder-/Kinder-/Jugendbuch/-film als utopische/dystopische Zukunftsvision: Wie leben wir in der Zukunft?Berlin als Ziel von Flucht und Immigration und damit verbunden mit Hoffnungen auf ein besseres Leben
- Berlin als Ort der Integration/Inklusion
- Berlin im Zentrum politischer Entscheidungen (siehe z.B. die 5. Staffel von , 2015)
- Thema Hauptstadt/Großstadt/Metropole: Wie wird Großstadtleben dargestellt?
- das Berlin der Zukunft unter ökologischen Gesichtspunkten
- Berlin als Topografie (sowohl im gesamten als auch auf einzelne Stadtteile bezogen) und einzelne Plätze, z.B. der Alexanderplatz, Tiergarten etc.
- architektonische Besonderheiten Berlins, die eine besondere Rolle in der Narration spielen, z.B. Plattenbau vs. Jugendstilvilla
- Autoren, die Berlin immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane machen, z.B. Erich Kästner, Klaus Kordon, Gabriele Beyerlein, Waltraut Lewin (hier gerne Analyse von Einzelwerken, aber auch des Gesamtwerkes)
Weitere Themen und Aspekte sind sehr willkommen und werden ebenfalls berücksichtigt!
Einsendeschluss für die Abstracts ist der 31. Oktober 2016
Wenn Sie sich mit einem Beitrag beteiligen möchten, senden Sie bitte ein Abstract im Umfang von 500 Wörtern und eine kurze Biografie an Dr. Sabine Planka (planka@phil.uni-siegen.de).
Weitere Informationen zum CFP finden Sie hier.
